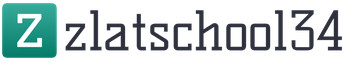Die Registerkarte befindet sich in der Entwicklung.
WISSENSCHAFTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN
- Kostomarov V.G. Über Anzeigetexte//Russische Sprache im Ausland.- 2019.- Nr. 1.- S. 61-64
- Kostomarov, V. G. Sprache ist mein Freund, Sprache ist mein Feind. Muttersprache // Russisches Wort im multikulturellen Raum: Sa. wissenschaftliche Arbeiten zum Jubiläum von Professor G.V. Yakusheva. - 2019. - S. 12-16
- Kostomarov V.G., Rusetskaya M.N. Herzlichen Glückwunsch an die Russisten von MAPRYAL vom Puschkin-Institut//Russische Sprache im Ausland.- 2017.- Nr. 6.- S. 7
- Kostomarov V.G. Grammatische Lehre des Wortes (im Gedenken an den Akademiker V. V. Vinogradov) / Im Buch: Russische Grammatik 4.0 Sammlung von Abstracts des Internationalen wissenschaftlichen Symposiums. Unter der allgemeinen Herausgeberschaft von V.G. Kostomarow. 2016. S. 22-25
- Maksimov V.I., Golubeva A.V., Voloshinova T.Yu., Ganapolskaya E.V., Kostomarov V.G., Nasonkina M.O., Ponomareva Z.N., Popova T.I. Russische Sprache und Sprachkultur // Lehrbuch für Junggesellen / Moskau, 2016. Ser. 58 Bachelor. Akademischer Kurs (3. Auflage, überarbeitet und erweitert).
- Kostomarov V.G. Erinnerung an V.V. Winogradow / Russische Sprache im Ausland. 2016. Nr. 3 (256). S. 10-11
- Burvikova N.D., Kostomarov V.G. Ist die Liebe zu einem Buch eine Quelle des Wissens? Blick und etwas/Russische Sprache im Ausland. 2016. Nr. 4 (257). S. 89-92
- Kostomarov V.G. „The Edge of the Beautiful“ // Moderator der Sendung, 4. Kanal TV1, 1. September 1993
- Kostomarov V.G. Russische Sprache der Zeit der Unruhen am Ende des 20. Jahrhunderts // Pulse. 1995. S. 4-7 (Interview)
- Kostomarov V.G. Die russische Sprache ist die Art und Weise, wie die Gesellschaft ist//Podmoskovnye Izvestiya. 21. Dezember 2000
- Kostomarov V.G. Ich bin ein Antiglobalist, wenn es um Kultur//Tribune geht. 11 September. 2003
- Kostomarov V.G., Maksimov V.I. Moderne russische Literatursprache in 2 Bänden//Lehrbuch / Moskau, 2015. Ser. 58 Bachelor. Akademischer Kurs (1. Aufl.). M.: Yurayt Verlag. 920 S.
- Kostomarov V.G. Wereschtschagin E.M. Sprache und Kultur. drei sprachliche und kulturelle Konzepte: lexikalischer Hintergrund, Sprachverhaltenstaktiken und Sapienteme. M.|Berlin, 2014. 509 S.
- Maksimov V.I., Golubeva A.V., Voloshinova T.Yu., Ganapolskaya E.V., Kostomarov V.G., Nasonkina M.O., Ponomareva Z.N., Popova T.I. Russische Sprache und Sprachkultur// Lehrbuch für Junggesellen / Moskau, 2013. Ser. 58 Bachelor. Akademischer Kurs (3. Auflage, überarbeitet und erweitert).
- Kostomarov V.G. Warum interessiert uns die Art des Kaffees, aber nicht, dass er nicht geneigt ist?//Russische Sprache. 2013. Nr. 1. S. 44-50
- Kostomarov V.G. Launen des russischen Stresses / Russische Sprache im Ausland. 2013. Nr. 1 (236). S. 43-48
- Kostomarov, V. G. Stilistik. Kompendium der Vorlesungen 2003/2004 Akademisches Jahr Bachelor des Staatlichen Instituts für Russische Sprache. ALS. Puschkin [Text] / V. G. Kostomarov. - M.: [geb. und.], 2012. - 255 S.
- Kostomarov V.G. Die Sprache des gegenwärtigen Augenblicks: das Konzept der Norm// Die Welt des russischen Wortes. 2012. Nr. 4. S. 13-19
- Kostomarov V.G. Vorwort. A. Onkovich. Mediendidaktik. Massenmedien im Bildungsprozess im In- und Ausland // Cap Lambert Academie Publishing, 2012. S. 3-7.
- Kostomarov V.G. Sprachleben. Von Vyatichi zu Moskauern / Moskau, 2011. Ser. Über alles auf der Welt für Eltern und Kinder. 288s.
- Kostomarov V.G., Nasonkina M.O., Ganapolskaya E.V., Voloshinova T.Yu., Popova T.I., Ponomareva Z.N. Russische Sprache und Sprachkultur. Lehrbuch / Herausgegeben von V.I. Maksimova, A.V. Golubew. Moskau, 2011. Ser. Grundlagen der Naturwissenschaften (2. Auflage, überarbeitet und erweitert). 358 S.
- Kostomarov V.G. Norm der Sprache und Normen in der Sprache (Interpretationserfahrung). Russische Sprache im Ausland. 2011. Nr. 4 (227). S. 55-59
- Kostomarov V.G. Wissenschaftler. Dichter. Aufklärer. Menschlich. Zum 300-jährigen Jubiläum von M.V. Lomonosov // Probleme der modernen Bildung. 2011. Nr. 6. S. 23-29
- Kostomarov V.G. V. I. Maksimov. Moderne russische Literatursprache / / Lehrbuch für Studierende geisteswissenschaftlicher Hochschulen / [Maximov V. I. und andere]; Hrsg. V. G. Kostomarova,. Moskau, 2010. Ser. Universitäten Russlands (2. Aufl., überarbeitet und ergänzt).
- Burvikova N.D., Kostomarov V.G. Hier gibt es den besten Unterricht! St. Petersburg, 2010. 63 S.
- Kostomarov V.G. Gogol als kulturpsychologisches und volkssprachliches Phänomen / Russische Sprache im Ausland. 2009. Nr. 2 (213). S. 8-9
- Wereschtschagin E.M. V.G. Kostomarow. Sprache und Kultur//Drei sprachkulturelle Experten. Konzepte: lex. Hintergrund, Rede. Taktiker und Sapientema / Ed. Yu.S. Stepanowa; Zustand. In-t rus. lang. ihnen. ALS. Puschkin. Moskau, 2008.
- Kostomarov V.G. Überlegungen zu den Formen des Textes in der Kommunikation // Staatliches Institut für Russische Sprache, benannt nach A.S. Puschkin, Moskau, 2008, S.84
- Kostomarov V.G. Burvikova N.D. Logoepistemische Komponente des modernen Sprachgeschmacks // Philologische Wissenschaften. 2008. Nr. 2. S. 3-11
- Kostomarov V.G. Unsere Sprache in Aktion//Wissen. Verständnis. Fähigkeit. 2008. Nr. 1. S. 34-37
- Burvikova N. D., Kostomarov V. G. Lesung „Ein kurzer Leitfaden zur Rhetorik für Liebhaber süßer Sprache“ von M.V. Lomonosov//M. V. Lomonosov und moderne Philologie. Wissenschaftliche Lesungen. - M.: Staat. IRA sie. ALS. Puschkin, 2008. - S. 17-21
- Kostomarov V.G. Sprache. Kultur. Zivilisation/№2. 2007, S. 93–101
- Kostomarov V.G. Sonnenaufgang. Abheben. Ein Sturz. Renaissance//Russische Sprache im Ausland. 2007. Nr. 1 (200). S. 14-16
- Kostomarov V.G. Unsere Sprache in Aktion // Alma Mater (Vestnik vysshei shkoly). 2007. Nr. 10. S. 5-7
- Kostomarov V.G. Burvikova N.D. Reproduzierbare Wortkombinationen als sprachlich-kognitives und terminologisches Problem / Nr. 2, 2006, S. 45-53
- Kostomarov V.G. Kurvikova N.D. Was ist ein Logoepistem? /№7. 2006. S. 13-17, M., RUDN
- Kostomarov V.G. Wereschtschagin E.M. Sprache und Kultur. Drei sprachkulturelle Konzepte: lexikalischer Hintergrund, Sprachverhaltenstaktiken und Sapienteme. 2005. M., 1037 S.
- Kostomarov V.G. Unsere Sprache in Aktion: Essays zur modernen russischen Stilistik. M., Gardariki, 2005. 287 S.
- Kostomarov V.G. Die Ansichten von V.V. Vinogradov über Stilistik und Perspektiven für ihre Entwicklung // Probleme der modernen Linguistik und Methoden des Unterrichts der russischen Sprache: Tagungsband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz zum Gedenken an den Akademiker V.V. Winogradow. Eriwan, 2004, S. 64-65
- Kostomarov V.G. Ereignisse, die etwas Optimismus wecken//Neuigkeiten aus der Bildung. 2003. Nr. 3. S. 6-7
- Kostomarov V.G. Einheiten des sprachkulturellen Raums (im Hinblick auf das Problem der Toleranz) / Mitautoren. mit N.D. Buravkina//Philosophische und sprachkulturologische Probleme der Toleranz. Jekaterinburg, 2003, S. 426-440
- Kostomarov V.G. Sprache in Bezug auf Kultur und Zivilisation//Slawistik, Buch. VII. Belgrad, 2003, S. 13-21
- Kostomarov V.G. Sprache im Verhältnis zu Kultur und Zivilisation//III Internationale Likhachev-Lesungen. SPb., 2003. S. 17-21
- Kostomarov V.G. Einheiten des sprachlichen und kulturellen Raums / Co-Autor. s.n.d. Buravkina//Russisch als Fremdsprache: Theorie, Praxis. Ausgabe. VI. SPb., 2003. S. 13-18
- Kostomarov V.G. Russische Sprache in der modernen Welt / Co-Autor. mit G.V. Chruslow // Essays zur Theorie und Praxis des Russischunterrichts als Fremdsprache. M., 2003. S. 7-21
- Kostomarov V.G. Wenig sagen, viel sagen / In et al. mit N.D. Burvikova//Russische Rede. 2003. Nr. 3. S. 39-41
- Kostomarov V.G. Massenkommunikation und die Entwicklung der russischen Sprache // Neues in Theorie und Praxis der Beschreibung und des Unterrichts der russischen Sprache. Warschau, 2003, S. 145-148
- Kostomarov V.G. Rette das Ewige // Journalismus und Kultur der russischen Sprache. 2003. Nr. 3. S. 9-12
- Kostomarov V.G. Probleme der russischen Sprache heute//Aktuelle Probleme Geisteswissenschaften. Ausgabe. 21. St. Petersburg, 2003. S. 117-127
- Kostomarov V.G. Nationalkulturelle Kommunikationseinheiten im modernen Kulturraum – ein sprachmethodischer Aspekt / Co-Autor. mit N.D. Burvikova//Vom Wort zur Tat. M., 2003. S. 40-46
- Kostomarov V.G. Auf der Suche nach neuen Entwicklungswegen der Sprach- und Landeskunde: Weltwissen außerhalb und durch die Sprache (Hypothese<лого>epistemes)/Co-Autoren. mit E.M. Wereschtschagin. M., 2002 (11. Authentisierungsblatt)
- Kostomarov V.G. Sprache im Recht. In was?//Rossiyskaya Gazeta. 25. Juni 2002
- Kostomarov V.G. Eine Reform der russischen Sprache in Russland gibt es nicht und kann es auch nicht geben // Bildungsnachrichten. 2002. Nr. 10/11. S. 19
- Kostomarov V.G. Die Rolle der russischen Sprache in der internationalen Kommunikation//Russische Sprache und Literatur als Mittel des interkulturellen Dialogs. Ulaan-Baatar, 2002. S. 3-10
- Kostomarov V.G. Sprachkultur und Sprachgeschmack//Russische Sprache und Literatur als Mittel des interkulturellen Dialogs. Ulaan-Baatar, 2002. S. 128-140
- Kostomarov V.G. Puschkins Moloch und der Moloch des Alten Testaments//Russische Rede. 2002. Nr. 2. S. 3-6
- Kostomarov V.G. Karnevalisierung des Lebens und Karnevalisierung der Sprache // Mitautoren. mit N.D. Burvikova//Theorie und Praxis der sprachstilistischen Analyse von Medientexten in forensischen Untersuchungen. M., 2002. S.34-48
- Kostomarov V.G. V.V. Winogradow. Essays zur russischen Geschichte literarische Sprache XVII-XIX Jahrhundert / Vorwort. bis zur 4. Aufl. M., 2002. S. 3-7
- Kostomarov V.G. V.V. Winogradow. Russisch. Grammatische Wortlehre / Vorwort. bis zur 4. Aufl. M., 2001. S. 3-4
- Kostomarov V.G. Entstehung von Logoepistemen/Mitautoren. mit N.D. Burvikova//Lehre und Forschung der russischen Sprache. Harbin, 2001. S. 31-48
- Kostomarov V.G. Russische Sprache zur Jahrtausendwende//Universitätstreffen. SPb., 2001. S. 212-220
- Kostomarov V.G. Lexikalischer Hintergrund: A-posteriori-Beobachtungen//Lernen und Lehren der russischen Sprache. Wolgograd. 2001. S. 12-27
- Kostomarov V.G. S.I. Ozhegov: Russische Sprache und „Russische Sprache“ // Wörterbuch und Kultur der russischen Sprache. M., 2001. S. 17-22
- Kostomarov V.G. Ein neuer Blick auf alte sprachliche Probleme // Russische Sprache im soziokulturellen Raum des 21. Jahrhunderts. Almaty, 2001. S. 4-16
- Kostomarov V.G. Das Russische als internationale Verkehrssprache//Sprachenpolitik in Europa. Berlin, 2001, S. 49–58
- Kostomarov V.G. Wereschtschagin E. M. Auf der Suche nach neuen Entwicklungswegen der Sprach- und Regionalwissenschaften: das Konzept des Logoepistemas//Haus des Lebens der Sprache. M., 2000. (6, 5 Autorenblätter)
- Kostomarov V.G. Bewahrer und Schöpfer der russischen Sprache und Kultur. Die Erfahrung mit der Anwendung von Methoden zur Berechnung von Bedeutungen auf die Werke von A.S. Puschkin/Co-Autoren. mit E.M. Wereschtschagin. M., 2000. (9, 25 aut. Blätter)
- Kostomarov V.G. Zur Sprache der Dissertationen//Bulletin VAK. M., 2000. S. 1-4
- Kostomarov V.G. Der Platz der russischen Sprache in der interkulturellen Kommunikation: Gestern, heute und morgen//Antologia 10 Encuentro nacional de profesores de Lenguas Extranjeras. Mexiko, 2000. S.71-80
- Kostomarov V.G. Moderner Dialog und die russische Sprache// Die Rolle von Sprache und Literatur in der Weltgemeinschaft. Tula, 2000. S. 3-9
- Kostomarov V.G. Logoepistema als „Dekoration“ der Sprache, aber nicht nur ... / In et al. mit N.D. Burvikova//Lehrfähigkeiten. M., 2000. S. 22-27
- Kostomarov V.G. Logoepistema als Kategorie sprachkulturologischer Suche // Sprachdidaktische Suche um die Jahrhundertwende. M., 2000. S. 88-96
- Kostomarov V.G. Wereschtschagin E.M. Sprachverhaltensstudien zu Puschkins Gleichnis von der verlorenen Tochter//Probleme der Linguistik. 2000. Nr. 2. S. 90-117
- Vereshchagin, E.M. Auf der Suche nach neuen Wegen zur Entwicklung sprachlicher und regionaler Studien: singuläre Sprachverhaltenstaktiken / Vereshchagin E.M., Kostomarov V.G. - M.: Staat. in-t der russischen Sprache. ALS. Puschkin, 2000. - 64 S.
- Efremova T.F., Kostomarov V.G. Wörterbuch der grammatikalischen Schwierigkeiten der russischen Sprache. M., 1999 (3. Aufl.).
- Kostomarov V.G. Sprachgeschmack der Zeit. Aus Beobachtungen zur Sprechpraxis der Massenmedien. M., 1999. 3. Aufl. – St. Petersburg. (19 automatische Blätter)
- Kostomarov V.G. Oh, großartig, mächtig, wahrhaftig und frei...//Landleben. 25. Februar 1999
- Kostomarov V.G. Moderne russische Sprache und kulturelles Gedächtnis // Moderne russische Sprache: Funktionsweise und Probleme des Unterrichts. Budapest, 1999. S. 30-32
- Kostomarov V.G. Die erste Vorlesung für die ersten Erstsemester. M., 1999 (2. Autorenblatt)
- Kostomarov V.G. Sprachliche Ansichten von A.S. Puschkin und die moderne soziolinguistische Situation//A.S. Puschkin und die Moderne. M., 1999. S. 34-43
- Kostomarov V.G. Puschkin und das moderne Russisch// Russische Sprache im Ausland.1999. Nr. 2. S. 30-36
- Kostomarov V.G. Ohne die russische Sprache haben wir keine Zukunft // Treffen mit einem Vertreter der GUS- und Baltikum-Staaten. M., 1999. S. 8-23
- Kostomarov V.G. Der Raum des modernen russischen Diskurses und Einheiten seiner Beschreibung / Mitautoren. mit N.D. Burvina//Russische Sprache im Zentrum Europas. 1999. Nr. 2. S. 65-76
- Kostomarov V.G. Wereschtschagin E.M. Auf der Suche nach neuen Entwicklungswegen der Sprach- und Landeskunde: das Konzept der Sprachverhaltenstaktik. M., 1999 (4,5 v.l.)
- Kostomarov V.G. Symbole früherer Kommunikationstexte // Studium und Lehre des russischen Wortes von Puschkin bis heute. Wolgograd. 1999. S. 7-14
- Kostomarov V.G. Sprache und „Sprache der Kultur“ in der interkulturellen Kommunikation / Co-Autor. mit E.M. Wereschtschagin//Russland-Ost-West. M., 1999. S. 349-356
- Kostomarov V.G. Sprachinformationseinheiten als Spiegelbilder von Sprache und Kultur//Fremdsprachen und ihr Unterricht. 1999. Nr. 10. S. 5-9
- Kostomarov V.G. Von Golgatha zu Golgatha // Journalist. 1996. Nr. 8. S. 32-36 (Interview)
- Kostomarov V.G. 30. Jahrestag von MAPRYAL//Russische Sprache im Ausland. 1998. Nr. 1. S. 8-14
- Kostomarov V.G. Die Rolle und der Platz der russischen Sprache in unseren Tagen//ELTE Idegennyelvi Tovabbkepao. Budapest, 1998. Nr. 2. S. 8-14
- Kostomarov V.G. Die russische Sprache wird für diese Welt benötigt //Russische Sprache. 1998. Nr. 2. S. 5-14
- Kostomarov V.G. Russische Sprachkultur im Uberblick//Europaische Sprachkultur und Sprachflege. Tübingen, 1998, S. 145-152
- Kostomarov V.G. Nationalkulturelle Besonderheit der Sprachkommunikation und ihre Rolle im Dialog der Kulturen//Russische Sprache und Literatur in Aserbaidschan. 1998. Nr. 2. S. 6-12
- Kostomarov V.G. Russische Sprache//Bild von Russland. Russische Kultur im globalen Kontext. M., 1998. S. 170-176
- Kostomarov V.G. Gribojedow lesen und ehren. Geflügelte Wörter und Ausdrücke / Co-Autor. mit N.D. Burvikova. M., 1998. (4 Autorenblätter)
- Kostomarov V.G. Im Dialog moderner Kulturen // Volksbildung. 1998. Nr. 5. S.63-67
- Kostomarov V.G. Merkmale des Verständnisses des modernen russischen Textes// Russische Studien: Sprachparadigma des Endes des 20. Jahrhunderts. SPb., 1998. S.23-28
- Kostomarov V.G. Das Bildungswesen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die russische Sprache//Vergleichende Erziehungswissenschaft. Festschrift für W. Mitter zum 7.Geburtstag. Frankfurt am Main, 1997. Nr. 1. Band 2 .C. 502-511
- Kostomarov V.G. Der Weg zu 30 Jahren//Russische Sprache. 1997. Nr. 1. S. 3-8
- Kostomarov V.G. Starre Struktur Texte und die kreative Natur des Sprachakts// Beherrschung des semantischen Raums der russischen Sprache durch Ausländer. Nischni Nowgorod, 1997. S. 10
- Kostomarov V.G. Anthropologisches Prinzip als Perspektive in der Entwicklung der Sprach- und Landeskunde / Co-Autor. mit N.D. Burvikova // Russisch als Fremdsprache: Sprachprobleme. M., 1997. S. 8-12
- Kostomarov V.G. Karnevalisierung als Merkmal des aktuellen Zustands der russischen Sprache: ein sprachmethodischer Aspekt / Mitautoren. mit N.D. Burvikova//Funktionale Semantik der Sprache, Semiotik von Zeichensystemen und Methoden ihrer Untersuchung. Teil 1. M., 1997. S. 23-24
- Kostomarov V.G. Ohne Sprache ist ein gemeinsamer Bildungsraum eine Illusion // Sprache. Kultur und Bildung: der Status der russischen Sprache in den Ländern der Welt. Moskau; Washington, 1997, S. 7-9
- Kostomarov V.G. Sprachgeschmack der Zeit. Aus Beobachtungen zur Sprechpraxis der Massenmedien. M., 1996 – 2. Aufl. - Moskau; Athen (19. v.l.)
- Kostomarov V.G. V.V. Winogradow über die russische Sprache als Phänomen der Weltkultur//Bulgarische Russistik. 1996. Nr. 1. S. 163-168
- Kostomarov V.G. Nicht nur die Sprache muss gerettet werden, sondern auch wir! // Gudok. 27. Januar 1996 (Interview)
- Kostomarov V. G. Philologen meistern die Stipendienfinanzierung // Bulletin der Russischen Stiftung für humanitäre Wissenschaft. 1996. Nr. 15. S. 6
- Kostomarov V. G. Philologen meistern die Stipendienfinanzierung // Bulletin der Russischen Stiftung für humanitäre Wissenschaft. 1996. Nr. 3. S.20-22
- Kostomarov V.G. Die großartige russische Sprache ist uns für immer geschenkt. Wahrheit-5. 1996. Nr. 16 (Interview)
- Kostomarov V.G. Die Sprache des Marktes // Kapital. 10.-16. April 1996 (Interview)
- Kostomarov V.G. Sprachliche und kulturelle Werteinheiten im russischen Text als „fremde“ Sprache (in Bezug auf ihre Anerkennung durch Ausländer) / Mitautor. mit N.D. Burvikova // Studium der Fremdsprachen. Harbin. 1996. Nr. 4. S. 1-6
- Kostomarov V.G. N.N. Tolstoi. Nachruf // Bulletin der Russischen Humanitären Stiftung. 1996. Nr. 3. S. 325–327
- Kostomarov V.G. „Izafet“ in der russischen Syntax der Phrase? // Wörterbuch. Grammatik. Text. M., 1996. S. 212–217
- Kostomarov V.G. Präzedenztext als reduzierter Diskurs // Sprache als Kreativität. M., 1996. S. 297-302
- Kostomarov V.G. Intertextualität im Hinblick auf den Unterricht der russischen Sprache für Ausländer / Co-Autor. mit N.D. Burvikova // Theorie und Praxis des Unterrichts slawischer Sprachen. Pecz., 1996, S. 5-11
- Kostomarov V.G. Die russische Sprache in einer sich schnell verändernden Welt//l 2 und darüber hinaus/ Lehren und Lernen moderner Sprachen/ Ottawa. 1995 (7. Autorenblatt)
- Kostomarov V.G. Mein Genie, meine Sprache. (Reflexion über Sprache in der Gesellschaft)/ Aus dem Russischen übersetzt von J. Woodsworth. Ottawa. 1995. (7 Authentisierungsblätter)
- Kostomarov V.G. Acad. V.V. Vinogradov über die russische Sprache als Phänomen der Weltkultur // Acad. V.V. Winogradow und die moderne Philologie. Sa. Thesen M., 1995. S.1-2
- Kostomarov V.G. Zur Sprache und zum Stil von Dissertationen // Bulletin der Höheren Bescheinigungskommission der Russischen Föderation. 1995. Nr. 2. S. 6-8
- Kostomarov V.G. VV Vinogradov über die russische Sprache als Phänomen der Weltkultur//Izvestiya AN. Reihe Literatur und Sprache. 1995. V.54. S. 49-54
- Kostomarov V.G. Lexiko-semantische Innovationen in der russischen Sprache//Text i slownik w nauczaniu jezyka i literatury rosyjskiej. Oppeln. 1995. S. 89-91
- Kostomarov V.G. Die Perspektiven der russischen Sprache nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Frankfurt am Main. 1995 (1 Authentisierungsblatt)
- Kostomarov V.G. Subjektive Modalität als Beginn des Diskurses / Co-Autoren. mit N.D. Burvikova//Acad. V.V. Vinogradov und moderne Philologie: Sa. Thesen. M., 1995. S.238
- Kostomarov V.G. Wir wurden mutig und verliebten uns in die Matte? // Lehrerzeitung. 1995.Nr. 129.S.9
- Kostomarov V.G. Das Wort Gesetzlosigkeit und die Aktivierung anderer Nicht-Suffix-Substantive // Philologische Sammlung. Zum 100-jährigen Jubiläum von Acad. V.V. Winogradow. M., 1995. S. 254-261
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für alle: Bildungskomplex / Pod. Hrsg. V.G. Kostomarowa, 1994
- Kostomarov V.G. Sprachgeschmack der Zeit. Aus Beobachtungen zur Sprechpraxis der Massenmedien. M., 1994 (19. Jahrgang)
- Kostomarov V.G. Sie haben bereits aufgehört, Angst vor uns zu haben, hatten aber noch keine Zeit, sich zu verlieben // Stawropolskaja Prawda. 29. März 1994
- Kostomarov V.G. Sprachleben. Von Vyatichi bis zu den Moskauern. M., 1994. (25,38 avt.l.)
- Kostomarov V.G. Überlegungen zur russischen Sprache//Forum. 1994. Nr. 3. S. 105–109
- Kostomarov V.G. Wie Texte zum Präzedenzfall werden / In et al. mit N.D. Burvikova//Russische Sprache im Ausland. 1994. Nr. 1. S. 73-76
- Kostomarov V.G. Über den Sprachgeschmack//Russische Sprache und Literatur in Schulen Kirgisistans. 1994. Nr. 1/2. S. 67-78
- Kostomarov V.G. Die Rolle der russischen Sprache im Dialog der Kulturen//Russische Sprache im Ausland. 1994. Nr. 5/6. S. 9-11
- Kostomarov V.G. Lebendige Prozesse der modernen russischen Sprache // Theorie und Praxis des Unterrichts slawischer Sprachen. 1994. S. 129-135
- Kostomarov V.G. Zur Sprache und zum Stil von Dissertationen // Arbeitsbuch des Vorsitzenden des Dissertationsrates. Krasnodar. 1994. S. 69-73
- Kostomarov V.G. Sprache und Kultur. Neu in Theorie und Praxis der Sprach- und Landeskunde / Co-Autor. mit E.M. Wereschtschagin. M., 1994. (2,5 v.l.)
- Kostomarov V.G. Neu in Theorie und Praxis der Sprach- und Landeskunde / Co-Autor. mit E.M. Wereschtschagin// Russische Sprache und Literatur im modernen Dialog der Kulturen. M., 1994. S. 56-57
- Kostomarov V.G. Sprachlicher und kultureller Aspekt der Methodik des Russischunterrichts als Fremdsprache. Kursprogramm. M., 1993 (2. Autorenblatt)
- Kostomarov V.G. „Menschliche Dimension“ als vielversprechende Richtung in der Entwicklung der Sprach- und Landeskunde. 1993. S.552-556
- Kostomarov V.G. Brauchen wir eine philologische Miliz?//Lehrerzeitung. 23. März. 1993
- Kostomarov V.G. Sprache ohne Fesseln und Ideologie//Russische Nachrichten. 2. September. 1993
- Kostomarov V.G. Russische Sprache in einer fremden Flut//Russische Sprache im Ausland. 1993. Nr. 2. S. 58-64
- Kostomarov V.G. MEDACTA 95 in Nitra//Pädagogik. 1993. Nr. 6. S. 37-94
- Kostomarov V.G. „Kieselsteine in der Handfläche“ (Reflexionen nach dem Unterricht): Schnell heißt schnell, aber wie übersetzt man stagnierend? // Russische Sprache im Ausland. 1993. Nr. 4. S. 57-61
- Kostomarov V.G. Die ungarischen Russen.//Russische Sprache im Ausland. 1993. Nr. 4. S. 101-104
- Kostomarov V.G. Im Land der Morgenstille//Russische Sprache im Ausland. 1992. Nr. 2. S. 124-126
- Kostomarov V.G. Garnelen unter Walen (südkoreanische Eindrücke)//Pädagogik. 1992. Nr. 4. S. 96-101
- Kostomarov V.G. Die russische Sprache muss geliebt und geschätzt werden...//Radiosendung. Moskauer Programm, 19. Juni 1992
- Kostomarov V.G. Pädagogisches Konzept und russische Sprache // Russische Sprache im Ausland. 1992. Nr. 4. S. 92-110
- Kostomarov V.G. Russische Sprache im „europäischen Zuhause“: gestern und morgen//La Eslavistica Europea: Problemas y Perspectivas. Granada, 1992, S. 60-62
- Kostomarov V.G. „Kieselsteine in der Handfläche“ (Reflexionen nach der Schule): Russische nichtrussische Wörter steil, zusammenbrechen, zusammenbrechen und andere. Schaufel, Klumpen und andere beschämende Wörter unserer Tage//Russische Sprache im Ausland. 1992. Nr. 5/6. S. 59-63
- Kostomarov V.G. Teilnehmer des Festivals sprechen//Russischer Ausländer. 1992. Nr. 2. C.5
- Kostomarov V.G. Noch einmal zum Begriff „Muttersprache“. Russische Sprache in der UdSSR. 1991. Nr. 1. S. 9-15
- Kostomarov V.G. Pädagogik im Spiegel des gesellschaftlichen Wandels. Pädagogik. 1991. Nr. 2. S. 3-13
- Kostomarov V.G. Mein Genie, meine Sprache. Überlegungen eines Linguisten im Zusammenhang mit öffentlichen Diskussionen über Sprache. M., 1991. (3,5 aut. Blätter). (In Kanada ins Englische und Französische übersetzt).
- Kostomarov V.G. Russische Sprache in einem fremdsprachigen Umfeld: funktionierendes Staatsstudium und Unterricht / Co-Autor. mit O.D. Mitrofanova. M. 1991. (2 Aufl.-Blätter)
- Kostomarov V.G. Probleme des Lernens und Methodenpluralismus / Co-Autor. mit O.D. Mitrofanova//Festschrift für Erwin Wedel zum 65. Geburtstag. München. 1991 S. 241-250
- Kostomarov V.G. Zurück zur ursprünglichen Bedeutung ... Öffentliche Bildung. 1991. Nr. 5. S. 18-22
- Kostomarov V.G. Sprachen und Kulturen in der Sowjetunion. Frankfurt am Main. 1991 (1,5 v.l.)
- Kostomarov V.G. Das Problem der Sprach- und Sprachkultur in der modernen russischen Gesellschaft//Russische Sprache und Literatur in Aserbaidschan. 1997. Nr. 1. S. 29-34
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für alle: Bildungskomplex / Pod. Hrsg. V.G. Kostomarowa, 1990
- Vereshchagin E.M., Kostomarov V.G. Sprache und Kultur: Sprach- und Regionalstudien im Unterrichten von Russisch als Fremdsprache. Moskau, 1990 (4. Auflage)
- Kostomarov V.G. Methoden zum Unterrichten von Russisch als Fremdsprache / Co-Autor. mit O.D. Mitrofanova und unter Beteiligung von M.N. Vyatyutneva, E. Yu. Sosenko, E.M. Stepanowa. M., 1990. (24,7 aut. Blätter)
- Kostomarov V.G. Die Funktionsweise der russischen Sprache: Ergebnisse, Zustand, Perspektiven / Co-Autor. mit L.N. Grigorieva und G.V. Chruslow. M., 1990 (1,1 aut. Blätter)
- Kostomarov V.G. Mitrofanova O.D. Muttersprache und andere Sprachen. Muttersprache. 1990. Nr. 9. S. 3-8
- Kostomarov V.G. Die Welt heute und die russische Sprache // Russische Sprache in der nationalen Schule. 1990. Nr. 11. S. 3-7
- Felitsyna, V. P. Russische Ausdruckseinheiten: Wörterbuch der Sprach- und Landeskunde / Felitsyna V. P. Mokienko V.M; Ed. Vereshchagina E.M., Kostomarova V.G. - M.: Russische Sprache, 1990. - 222 S.
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für alle: Bildungskomplex / Pod. Hrsg. V.G. Kostomarowa, 1989
- Kostomarov V.G. Amerikanische Version der Sprach- und Regionalwissenschaften (Überprüfung des Konzepts der „Literary Literacy“). Russische Sprache im Ausland. 1989. Nr. 6. S. 72-80
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für alle: Bildungskomplex / Pod. Hrsg. V.G. Kostomarowa, 1988
- Kostomarov V.G. Zeit- und Ortszeichen in den Redewendungen und Denkaktivitäten / Co-Autor. mit E.M. Wereschtschagin//Sprache: System und Funktionsweise. M., 1988
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für alle: Bildungskomplex / Pod. Hrsg. V.G. Kostomarowa, 1987
- .Kostomarov V.G. Internationale Funktionen der russischen Sprache// Bulgarische Russischstudien. 1987. Nr. 3. S. 3-12
- Kostomarov V.G. Perestroika und die russische Sprache. Russische Rede. 1987. Nr. 6. S. 3-11
- Linguistik und Text: Sa. Artikel / Komp. ESSEN. Wereschtschagin, V.G. Kostomarow. - M.: Russische Sprache, 1987. - 179 S.
- Kostomarov V.G. Methodische Theorie und Praxis des Russischunterrichts in verschiedenen Ländern. Ergebnisse und Aussichten / In et al. L. Gorokhovsky, A. Mustajoki. Budapest, 1986. (1 Authentisierungsblatt). (Das Werk wurde im Ausland nachgedruckt).
- Kostomarov V.G. Russische Sprache und amerikanische Konzepte der Weltsprache // Russische Sprache in der Nationalschule. 1986. Nr. 7. S. 9-17
- Kostomarov V.G. Wörterbuch der grammatikalischen Schwierigkeiten der russischen Sprache. M., 1986.
- Efremova T.F., Kostomarov V.G. Wörterbuch der grammatikalischen Schwierigkeiten der russischen Sprache. M., 1986.
- Kostomarov V.G. Allgemeine und spezielle Entwicklung der Sprachen // Literatur. Sprache. Kultur. M., 1986. S. 267-278
- Kostomarov V.G. Besonderheiten des sprachlichen Denkens als methodisches Problem / In et al. mit A. Ahuja und S.G. Minasova//Bulletin der Moskauer Staatlichen Universität. Serie IX-Philologie. 1986. Nr. 3. S. 72-81
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für alle: Bildungskomplex / Pod. Hrsg. V.G. Kostomarowa, 1985
- Kostomarov V.G. Methodischer Leitfaden für Lehrer der russischen Sprache für Ausländer / Co-Autor. mit O.D. Mitrofanova. M., 1984 (3. Aufl.)
- Kostomarov V.G. Sprachleben. M., 1984. (6 Authentisierungsblätter)
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für alle: Bildungskomplex / Pod. Hrsg. V.G. Kostomarowa, 1983
- Kostomarov V. G., Mitrofanova O. D. Bildungsprinzip der aktiven Kommunikation beim Russischunterricht für Ausländer. Berichte der Delegation beim III. Kongress von MAPRYAL. M., 1982. S. 3-20 (Das Werk wurde in der UdSSR und im Ausland nachgedruckt)
- Interview mit dem Direktor des Instituts für Russische Sprache. ALS. Puschkin V.G. Kostomarov und Kopf. Bereich für Sprach- und Regionalstudien des Instituts für Russische Sprache. ALS. Puschkina E.M. Wereschtschagin // Russische Sprache im Ausland.- 1982.- Nr. 1.- S. 56-58
- Kostomarov V.G. am Institut für Russische Sprache. ALS. Puschkin (September-Oktober 1981) // Russische Sprache im Ausland.- 1982.- Nr. 1.- S. 119-120
- Kostomarov V.G., Mitrofanova O.D. „... bis er seine Muttersprache vergisst“ // Russische Sprache im Ausland. - 1982. - Nr. 3. - S. 60-64
- Aktivität Internationale Vereinigung Lehrer für russische Sprache und Literatur 1979-1982. Bericht des Generalsekretärs von MAPRYAL Prof. V.G. Kostomarov auf der V. Sitzung der MAPRYAL-Generalversammlung am 22. August 1982 // Russische Sprache im Ausland. - 1982. - Nr. 6. - S. 47-52
- Kostomarov V.G., Smirnova G.A. OK. Graudina Fragen der Normalisierung der russischen Sprache. Grammatik und Varianten.- M., 1980//Russische Sprache im Ausland.- 1982.- Nr. 6.- S. 115-116
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für alle: Bildungskomplex / Pod. Hrsg. V.G. Kostomarowa, 1981
- Kostomarov V.G. Sprach- und Regionaltheorie des Wortes / Co-Autor. mit E.M. Wereschtschagin. M., 1980 (17 Authentisierungsblätter)
- Kostomarov V.G. Die Kultur der Sprache und die Art und Weise ihrer Bildung//Russische Sprache und Literatur in den Schulen der Ukrainischen SSR. 1980. Nr. 4. S. 51-56
- Kostomarov V.G., Mitrofanova O.D. Zu den Ergebnissen der Diskussion „Lehrbuch der russischen Sprache und Probleme der Berücksichtigung von Fachgebieten“ // Russische Sprache im Ausland. - 1980. - Nr. 6. - S. 50-54
- Methodik als Wissenschaft. Artikel 1. Kostomarov V.G., Mitrofanova O.D. Russische Sprache im Ausland. 1979. Nr. 2. S. 56-61
- Methodik als Wissenschaft. Artikel 2. Kostomarov V.G., Mitrofanova O.D. Russische Sprache im Ausland. 1979. Nr. 6. S. 67-73
- Kostomarov V.G. Lehrbuch der russischen Sprache für Ausländer: Typisierung und Vollständigkeit / Co-Autor. Außendurchmesser Mitrofanova // Bulletin der Höheren Schule. 1979. Nr. 3. S. 74-78
- Kostomarov V.G. Mehrere Überlegungen im Zusammenhang mit der Idee eines „Standardbildungskomplexes“//Russische Sprache in der Schule. 1979. Nr. 5. S. 8-14
- Kostomarov V.G. Aktivitäten der Internationalen Vereinigung der Lehrer für russische Sprache und Literatur in den Jahren 1977-1979//Russische Sprache im Ausland.- 1979.- Nr. 6.- S. 36-40
- Sprach- und Landeskunde im Russischunterricht als Fremdsprache: Sammlung wissenschaftlicher und methodischer Artikel / Ed. Vereshchagina E.M., Kostomarova V.G. - M.: Russische Sprache, 1979. - 216 S.
- Kostomarov V.G. Methodischer Leitfaden für Lehrer der russischen Sprache für Ausländer / Co-Autor. mit O.D. Mitrofanova. M., 1978 (2. Aufl.)
- Kostomarov V.G. Ursachen und Art des Fortschritts der russischen Sprache in unseren Tagen // Bulletin der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. 1978. Nr. 10. S. 85-100
- Kostomarov V.G. Russische Sprache für Touristen. In Spalte. mit A.A. Leontiev; Englisch. Deutsche, französische, italienische, japanische Ausgaben. M., 1978-1990 (8 Autorenblätter).
- Kostomarov V.G., Mitrofanova O.D. Lehrbuch der russischen Sprache und das Problem der Bilanzierung des Fachgebiets // Russische Sprache im Ausland. - 1978. - Nr. 4. - S. 49-53
Basierend auf einer Vielzahl von Faktenmaterial analysiert das Buch die Prozesse, die in der Sprache moderner Massenmedien ablaufen. Es wird auf die immer größere Rolle der Medien bei der Bildung der Sprachnorm hingewiesen und der Begriff des Geschmacks als Einflussfaktor auf die Norm eingeführt, der die Richtung der Sprachentwicklung erklärt. Das Buch richtet sich an ein breites Spektrum von Lesern, die sich Sorgen um das Schicksal ihres Heimatwortes machen.
Einleitung: Problemstellung
0,1. Am meisten gemeinsames Merkmal lebendige Prozesse, die in der russischen Literatursprache unserer Tage beobachtet werden, ist es unmöglich, die Demokratisierung nicht zu erkennen - in dem Verständnis, das in der Monographie von V.K. Zhuravlev „Wechselwirkung äußerer und innerer Faktoren bei der Entwicklung der Sprache“ (M., Nauka, 1982; Aktuelle Aufgaben der modernen Sprachdidaktik, in: „Sprachliche und methodische Probleme des Russischunterrichts als Nicht-Muttersprache. Aktuelle Probleme des Kommunikationsunterrichts“, M., 1989). Am deutlichsten demokratisiert sind Bereiche der literarischen Kommunikation wie die Massenkommunikation, einschließlich der Schriftsprache von Zeitschriften.
Der Begriff Liberalisierung ist jedoch zutreffender, um diese sich sehr schnell entwickelnden Prozesse zu charakterisieren, da sie nicht nur Auswirkungen haben Volk Schichten der nationalen russischen Sprache, aber auch gebildet was sich als dem literarischen Kanon der letzten Jahrzehnte fremd erwies. Insgesamt wird die literarische und sprachliche Norm weniger eindeutig und verbindlich; der literarische Standard wird weniger standardisiert.
In gewisser Weise wiederholt sich die Situation der 20er Jahre, als der postrevolutionäre rosafarbene Optimismus den Wunsch weckte, nicht nur das Gesellschaftssystem und die Wirtschaftsstruktur, sondern auch die Kultur, aber auch den literarischen Sprachkanon tiefgreifend zu verändern. Natürlich beurteilten Zeitgenossen das Geschehen ganz anders (siehe: L. I. Skvortsov. Zur Sprache der ersten Oktoberjahre. RR, 1987, 5; vgl. S. O. Kartsevsky. Sprache, Krieg und Revolution. Berlin, 1923; A. M Selishchev, Sprache der revolutionären Ära, Moskau, 1928). Eine solche soziale Situation stimmt gut mit den Ideen von A. A. Shakhmatov über die Erweiterung der Grenzen der literarischen Sprache überein, und genau so dachten und handelten die Vertreter, wie S. I. Ozhegov es ausdrückte: neue sowjetische Intelligenz. Insbesondere Methodisten argumentierten, dass das traditionelle Subjekt Muttersprache In der russischen Schule gibt es tatsächlich das Studium einer Fremdsprache, das erfordert, „das Studium der Standardsprache zu erweitern ... die Dialekte zu studieren, von denen unsere Standardsprache umgeben ist und aus denen sie sich speist“ (M . Solonino. Zum Studium der Sprache der Revolutionszeit. „Russische Sprache in der sowjetischen Schule“, 1929, 4, S. 47).
Die zumeist im Exil lebende „alte Intelligenz“ vertrat die Unantastbarkeit der Literatursprache und empörte sich über deren Überschwemmung mit Dialektismen, Jargon, Fremdheit und sogar sich ändernden Rechtschreibregeln, insbesondere der Vertreibung des Buchstabens „yat“. Dieser diametral entgegengesetzte Ansatz setzte sich auch innerhalb des Landes durch, tauchte in den 1930er Jahren auf und setzte sich zweifellos in den 1940er Jahren durch. Die Diskussion im Jahr 1934, verbunden mit der Autorität von M. Gorki, skizzierte den Weg zur Massenkultivierung der Sprache, anspruchsvoll Schreiben Sie auf Russisch, nicht auf Wjatka, nicht in Roben. Bewusst Proletarische Sprachpolitik wurde unter dem Motto der Überwindung der vor allem bäuerlichen Mehrsprachigkeit abgehalten - eine einzige Landessprache für alle Arbeitnehmer. Auch die sprachliche Variabilität war in der Literatursprache selbst eingeschränkt.
Aufgrund dieser zwangsläufig schematischen und vereinfachten Ereignisse der Geschichte sowie einer Reihe weiterer Ereignisse gelangten wir in die 50er Jahre mit einer sehr verknöcherten und streng durchgesetzten literarischen Norm, die der gesellschaftspolitischen Situation eines totalitären Staates voll und ganz entsprach . Am Ende des ersten Nachkriegsjahrzehnts begannen frei denkende Schriftsteller dagegen anzukämpfen – sowohl in ihrer Praxis als auch in der Theorie, und K. I. Chukovsky stand an der Spitze dieser Entwicklung. Die Rückkehr zu lebendigen Orientierungen war jedoch schmerzhaft. Russland insgesamt erwies sich als eher konservativ als innovativ.
Wird sich die Geschichte wiederholen? Jetzt hat unsere Gesellschaft zweifellos den Weg eingeschlagen, die Grenzen der literarischen Sprache zu erweitern und ihre Zusammensetzung und ihre Normen zu ändern. Darüber hinaus wird das normale Tempo der sprachlichen Dynamik stark erhöht, was zu einer unerwünschten Lücke in der Kontinuität der Traditionen und in der Integrität der Kultur führt. Solche Prozesse der 1920er Jahre haben mit ihrer schöpferischen Ausrichtung auf die Liberalisierung der Sprache, auch wenn sie schnell auf Eis gelegt wurden, bedeutende Spuren in unserer gebildeten Kommunikation hinterlassen. Und auch jetzt werden immer lauter Stimmen laut, die Befürchtungen über den Zustand der russischen Literatursprache äußern, zu dem das Folgende auf dem Weg der Erweiterung literarischer und sprachlicher Grenzen führt.
Sogar diejenigen, die den siegreichen Liberalismus begrüßen, denen er vor dem Hintergrund der Abkehr der Gesellschaft von der trägen autoritären Einstimmigkeit zur Freiheit, zur Freiheit, zur Vielfalt durchaus gerechtfertigt erscheint, protestieren gegen die Rücksichtslosigkeit dieses Prozesses, gegen die Extreme im wünschenswerten Verlauf der Dinge . Sie stimmen der Forderung von A. S. Puschkin zu, der russischen Sprache „mehr Freiheit zur Entwicklung gemäß ihren Gesetzen“ zu geben, und wollen Sorglosigkeit, Lockerheit im Sprachgebrauch und Freizügigkeit bei der Wahl der Mittel nicht ruhig ertragen des Ausdrucks. Aber in diesen Phänomenen sehen sie nicht die unvermeidlichen Folgen einer gerechtfertigten Haltung, sondern nur einzelne, wenn auch auf Massenebene häufige Erscheinungsformen des niedrigen kulturellen Niveaus der Bevölkerung, elementarer Unkenntnis der Normen der Literatursprache und der Gesetze der Stil.
Zweifellos, und das ist der Fall, verschlimmert es die Ergebnisse des bewussten Handelns recht gebildeter und kultivierter Menschen, die sich der Normen und Gesetze des Stils wohl bewusst sind. Dies belegen folgende experimentelle Daten: Moskauer Schulkinder verzichten in 80 % der Sprachsituationen, in denen die Verwendung von Sprachetikettenformeln erforderlich ist, auf diese; etwa 50 % der Jungen sprechen sich gegenseitig mit Spitznamen an, von denen mehr als die Hälfte beleidigend ist; Etwa 60 % der Schüler verwenden Briefmarken, die nicht die Aufrichtigkeit ihrer Gefühle ausdrücken, wenn sie Eltern, Lehrern und Freunden gratulieren. Der Autor dieser Berechnungen ist der Ansicht, dass es immer notwendiger wird, Kindern in der Schule gezielt die anerkannten Kommunikationsregeln beizubringen (N. A. Khalezova. Über die Möglichkeiten der Arbeit an der Sprachetikette beim Studium von grammatikalischem Material. РЯШ, 1992, 1, S. 23).
Bezeichnend ist, dass mittlerweile ein deutlicher Rückgang des künstlerischen Geschmacksniveaus zu verzeichnen ist. So verlassen beispielsweise laut einer soziologischen Studie nur noch 15 Prozent der Kinder mit ausgeprägtem künstlerischem Geschmack die städtischen Schulen, während es Anfang der 80er Jahre etwa 50 waren Prozent; V ländliche Schulen jeweils 6 und 43 %. Die Vorliebe der Bevölkerung konzentriert sich hauptsächlich auf ausländische Kunstschichten, und besonders beliebt sind Kammerhandlungen, die sich der Liebe, Familie, Sex, Abenteuern widmen, sowie leichte Musik, deren Qualität als Filmdetektiv zweifelhaft ist. (Yu. U. Fokht-Babushkin. Künstlerische Kultur: Probleme des Studiums und des Managements. M.: Nauka, 1986; sein eigenes. Künstlerisches Leben Russlands. Bericht an die Russische Akademie für Bildung, 1995.)
Für helles Feuer der Kritik sorgen die Medien, vor allem das Fernsehen. Und hier geht es nicht nur um Verstöße gegen die literarische und sprachliche Norm, sondern gerade um die Missachtung des Wortes, um Versuche, das „Sprachzeichen“ und damit die nationale traditionelle Mentalität zu verändern. Das russische Sprichwort „Was mit der Feder geschrieben ist, lässt sich nicht mit der Axt abschneiden“ scheint an Kraft zu verlieren. Dies ist es, was viele dazu bringt, sich einer solchen Beobachtung des Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten der Moskauer Regierung V. Resin anzuschließen: „In der Presse wütet eine Art schreckliche Epidemie der Unzuverlässigkeit, der Verzerrung von Zahlen, Fakten, Worten und Situationen“ (November 2011). ., 24.1.98). Im Einklang mit einigen medizinischen Interviews klingen die Worte des Akademikers A. I. Vorobyov: „Wir sprechen über unseren gemeinsamen Sündenfall. Wir reden zu viel und denken zu wenig darüber nach, wie unsere zufällig geworfenen Phrasen auf das Schicksal anderer Menschen reagieren werden“ (MK, 24.1.98).
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum die traditionelle Phraseologie zerstört wird ( Keiner der Machthaber äußerte Empörung- „Sowjetrussland“, 29.11.97 – Verunreinigung der Ausdrücke Macht halten Und diejenigen, die an der Macht sind. Der kürzeste Weg nach Rom- Handywerbung im Januar 1998, die bekannte Ausdrücke widerlegt Alle Wege führen nach Rom, die Sprache führt nach Kiew usw.), wird der übliche Satz verletzt ( knarrendes Herz - TV RTR 9.11.97, in der Wettervorhersage „Mayak“ 29.12.97: am kältesten, am wärmsten dort statt am wärmsten). Akzeptierte stilistische Anstandsregeln werden verworfen (in der Rede des Moderators des Radiosenders Silver Rain A. Gordon am Morgen des 4.8.97: Es tut mir wahnsinnig leid, ein neuer Witz, na ja, wenn Sie pieksen, wird eine CD herausgebracht und eine Kassette für arme Rocker. Auch für Prêt-à-porter steht das Podium des Avantgarde-Modepublikums offen- AiF, 1996, 34), direkte Fehler sind erlaubt ( Sie können darauf verzichten, dass sie nicht einmal die ersten Hundert erreicht haben -„Mozhayskoe Highway“, 1997, 7, obwohl es im russischen Wörterbuch nur ein Verb gibt murren. Ich hoffe, es gibt keine Einwände- Radio Moskau, 16.5.97. Wie spät ist es- ORT, 20.6.97. Weigerte sich, die Vollmacht an seinen Empfänger zu übergeben- ORT, 15.8.97 In der Rede des Ansagers Z. Andreeva, der das Empfangsgerät mit dem Nachfolger des Falles verwechselt, wird Gleichgültigkeit gegenüber der Aussprache zum Ausdruck gebracht ( Leg dich ins Krankenhaus- ORT, 24.6.97; zusammen und getrennt- ORT, 14.2.98. Links vom Aufzug- ORT im Juni 1997 in einer täglichen Werbung für den Film mit Richard – erst bei der Ausstrahlung am 26.6.97 hat der Ansager den Akzent richtig gesetzt).
Ein aufmerksamer Leser moderner Zeitungen, ein Radiohörer und ein Fernsehzuschauer können die Liste solcher Beispiele leicht endlos machen. Und tatsächlich liegt der Punkt nicht in ihnen als solchen, sondern gerade in ihrem Massencharakter, in einer gewissen Geschmacksgleichgültigkeit von Schriftstellern und Rednern, ihrer oft bewussten normativ-sprachlichen Disziplinlosigkeit. Es ist unwahrscheinlich, dass sie geschrieben hätte, wenn sie noch einmal gelesen hätte, was sie geschrieben und gedacht hätte, die Journalistin hätte eine solche Passage: Nachtclub „Sophie“. Kühles Licht, tiefer Sound, die Tanzfläche ist von Säulen umgeben. Erotikshow „Topless Models“ mit Vollendung(Center-plus, 1997, 48).
Daher wäre es naiv, alles, was passiert, nur auf Nachlässigkeit und Analphabetismus zurückzuführen, insbesondere angesichts des sehr guten Bildungsniveaus der Bevölkerung in der ehemaligen UdSSR. Natürlich sind die Menschen heute im Allgemeinen gebildeter als früher, aber die Norm war damals eindeutiger und wurde strenger eingehalten. Darüber hinaus sind die Initiatoren eines freieren Sprachgebrauchs mittlerweile nur noch recht gebildete Menschen – Journalisten und andere Fachleute des Fachs. Es ist schon bezeichnend, dass sie „Befreiung der Sprache“ nennen, was die Intelligenz der älteren Generation als „Barbarisierung“ oder „Vandalisierung“ ansieht.
Äußerst bezeichnend sind die gegenseitigen Vorwürfe der „Unkenntnis der russischen Sprache“, die zwischen Journalisten von Chimes, Moskovskaya Pravda und Moskovsky Komsomolets ausgetauscht werden, d Look“, 1993, 38). Zwar wird auch die Meinung geäußert, dass wir vor einem „zerstörerischen Ansturm der Bildung“ stehen (Yu. D. Apresyan. Zitiert nach: Yu. N. Karaulov. Zum Zustand der russischen Sprache unserer Zeit. M., 1991, S. 38). Die Analyse des Faktenmaterials überzeugt uns davon, dass wir zweifellos vor einer bewusst gestalteten Tendenz stehen, die den Verlauf aller gesellschaftlichen Entwicklungen widerspiegelt.
Das unterstrichene, man könnte Karneval sagen (siehe: N. D. Burvikova, V. G. Kostomarov. Karnevalisierung als Merkmal des aktuellen Zustands der russischen Sprache. Im Buch: Functional Semantics of Language ... M., 1997) ist es leicht Sehen Sie die Vernachlässigung der Norm beispielsweise in der Verbreitung einer komischen Art und Weise, Varianten von oszillierenden Formen zu verwenden, als ob sie ihre mangelnde Bereitschaft betonen würden, zu verstehen, was richtig und was falsch ist. In der Sendung über die Oligarchen, die das Land regieren, hieß es also: Beim Glück geht es nicht um Geld oder, wie die Künstler sagen, Geld... Es geht also um Geld oder, wenn man so will, um Geld(Radio Moskau, 13.12.98). M. Leonidov, Moderator der Sendung „Diese lustigen Tiere“, in den Worten des Teilnehmers Ich mag keinen Hüttenkäse … oder, wie es sein sollte, Hüttenkäse? bemerkte: Das ist egal. Unsere Sendung ist nicht auf Russisch; Am Ende sagte er: Nun, Sasha, wir sind bei dir angekommen. Oder dort angekommen – egal(ORT, 15.10.98). Dementsprechend sind wissenschaftliche Normalisierer immer eher bereit, „akzeptabel“ zu bewerten ( Hüttenkäse, hinzufügen. Hüttenkäse, Schicksal und veraltet. Schicksal, Denken Und Denken…).
Wenn wir uns daran erinnern, dass das Spiel mit Formen Mädchen – Mädchen, weit – breit- ein anerkanntes Mittel der Volksdichtung, wenn man bedenkt, dass die Variabilität in der russischen Literatursprache des letzten halben Jahrhunderts deutlich unterschätzt wurde, dann kann man nicht umhin zuzugeben, dass wir einen völlig legitimen Indikator für die Zeit wackeliger Normen, der Koexistenz von Varianten bzw. haben ihr historischer Wandel.
Man kann sozusagen weitere Beispiele für die ruhige Haltung der Menschen gegenüber ihrer Unsicherheit in der Sprache nennen, für die sie sich nicht mehr schämen. Der Mayak-Sprecher am Mittag des 31. Dezember 1996 versprach keineswegs, herauszufinden, wie die Ziffern abnehmen, sondern erklärte ohne jegliche Verlegenheit sogar stolz: Sie sehen – bei diesen, nun ja, nummerierten Worten wird mir schlecht. Das ist heute Mode. Die Frage nach der Bewertung dessen, was bekämpft und womit man sich versöhnen muss, wird immer offensichtlicher.
Die ablaufenden Prozesse basieren auf Veränderungen in der psychologischen Einstellung der Massen, die die russische Sprache verwenden, in ihrem Sprachgeschmack und ihrer Intuition für die Sprache. Diese gesellschaftlich und historisch bedeutsamen Phänomene erhalten manchmal eine Art offizielle Zustimmung (zumindest am Beispiel der Rede politischer Autoritäten und der Redepraxis der Massenmedien) und manchmal sogar eine gesetzgeberische Konsolidierung. Aber das Wichtigste ist die öffentliche Ästhetik, der Wunsch danach Was als schön verstanden. „Es ist schön“, so die bedeutungsvolle Bemerkung von Maya Plisetskaya, „was in Mode ist“ (Izv., 28.3.95).
Betrachten wir zwei anschauliche Beispiele, die dazu beitragen, das Konzept des Geschmacks (und der Mode) als eine Kategorie zu objektivieren, die die Entwicklung der Sprache beeinflusst und sogar die Richtung ihrer Dynamik bestimmt.
0,2. Das beste Beispiel können Appelle sein, insbesondere die Art und Weise, Menschen im offiziellen Rahmen beim Vor- und Nachnamen zu nennen, die sich vor allem in Radio und Fernsehen verbreitet hat. Nicht ohne die Erinnerung an diejenigen, die die sinnlosen Volltitel satt hatten Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, Genosse Breschnew Leonid Iljitsch Es entsteht eine neue Norm für die Benennung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Politik, genauer gesagt wird die Tradition der Benennung von Künstlern und Schriftstellern mit Vor- und Nachnamen auf sie übertragen, was übrigens auch der westeuropäischen Tradition entspricht: Boris Jelzin, Jegor Gaidar, Michail Gorbatschow, Pawel Gratschow, Viktor Tschernomyrdin.
Dies wurde natürlich von den Anhängern der Tradition und Ordnung sofort bemerkt und verurteilt: Es ist in Mode gekommen, über den einen oder anderen unserer Führer und andere Personen zu schreiben, ohne das Wort „Genosse“ (oder zumindest „Genosse“ oder einfach „Genosse“) zu erwähnen. Sie begannen, nur ihre Namen anzugeben, ohne Vatersnamen (M. Gorbatschow, N. Ryschkow) oder sogar Michail Gorbatschow, Nikolai Ryschkow, Anatoli Sobtschak zu schreiben ... Haben wir uns schon für die Anrede „Genosse“ geschämt? Ist unsere Gewohnheit, eine Person beim Vornamen, Vatersnamen oder vollständigen Initialen zu nennen, für uns ungünstig geworden? Schließlich wurden in Russland nur Zaren und Geistliche der Kirche namentlich genannt. Heutige Journalisten müssen darauf achten, den Affen zu spielen und von Ausländern zu übernehmen, was Tradition und ihnen vertraut ist, was uns aber nicht nur in den Ohren weh tut, sondern uns auch keine Ehre erweist.(Misha, Tolya, Kolya und andere Beamte. Izv., 2.1.91).
Hohe Emotionen, die seit Jahrzehnten im Wort Kamerad gepflegt werden (sie mussten bei Bedarf sogar entfernt werden: Ich begann den Brief mit dem Appell „Lieber Kamerad ...“ So ist es üblich. Aber Sie verstehen natürlich, dass dies nur eine Form der Höflichkeit ist ... Izv., 27.11.72), bereits in der Mitte der Perestroika-Ära waren sie von abwertenden Untertönen überwuchert. Offenbar verbreiteten sich daher plötzlich und epidemisch neue Appelle - Mann Frau. Bereits in den frühen 80er Jahren verlor die Öffentlichkeit das Interesse an diesem stolzen Wort Wir sind teurer als alle schönen Worte. In der Geschichte dieses Wortes wiederholte sich, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, das, was ihm in den 20er Jahren widerfuhr, als laut Emigration „das schöne Wort Kamerad zu einem leeren Appell wurde“ (S. und A. Volkonsky. In Verteidigung der russischen Sprache. Berlin, 1928, S. 20; für Einzelheiten siehe: S. I. Vinogradov, The Word in Parliamentary Speech and the Culture of Communication, RR, 1993, Nr. 2, S. 54).
Versuche, es zu vermeiden und zu ersetzen, sorgten jedoch lange Zeit für Verurteilung. Hier ist eine typische Zeitungserinnerung, dass „wir immer und überall Kameraden sind“: „Mann, mach weiter!“, „Frau, gib das Ticket weiter!“ - Solche Appelle sind oft auf der Straße, in der U-Bahn, im Laden zu hören. Oder aber – ein junger Mann wendet sich an eine ältere Verkäuferin: „Mädchen, gib mir ein Pfund Zucker“ ... Wir haben ein wunderbares Wort Kamerad auf Russisch. Warum sagen wir also nicht: Kamerad Verkäufer, Kamerad Fahrer, Kamerad, bitte geben Sie den Strafzettel weiter?(Izv., 27.11.83)
Diese Bemerkung ist typisch: Das Wort „Kamerad“, das immer die höchste geistige Einheit bedeutete, wurde im Gegenteil zum Zeichen kalter Entfremdung. Wenn sie „Genosse so und so“ sagen, bedeutet das, dass sie mit einer Person unzufrieden sind. Der erhabene leninistische „Bürger“ ist jetzt, wenn eine Person gefasst wird. Um die früheren Kriterien zu ersetzen, die sich irgendwie vegetativ von einem zum anderen schleichen, breiten sich andere aus.(LG, 1988, 16).
Bereits Ende 1991 wurde in einer Durchsicht von Briefen eine Stellungnahme zitiert: Warum sprechen manche in Moskau das Publikum mit „Herren“ statt mit „Genossen“ an? Wer erlaubte den Leuten von Iswestinski, das Wort „Herren“ in eine Anzeige für die Moskauer Warenbörse zu schreiben? Das ist unsere Zeitung, nicht bürgerlich. Ein Zeitungskommentar verteidigte die Freiheit: „Gefällt es Ihnen, als ‚Genosse‘ bezeichnet zu werden? Kontaktieren Sie uns!.. Einige reagieren allergisch auf das Wort „Herren“, andere auf das Wort „Genosse“. Unsere Partnerschaft ist ein rein bedingtes Konzept, ebenso wie das Wort „Herren“. In Georgien beispielsweise verschwanden die Wörter „batono“ – Meister und „kalbatono“ – Frau nie aus dem Lexikon, insbesondere für Fremde. Das ist ein Zeichen des Respekts. Und auf die banale Trolleybus-Frage „Fahren Sie jetzt los?“ Sie antworten nicht mit „Ja“, sondern in der Regel mit „Diah, Batono“ – oh ja, Sir! Und wenn jemand in diesem Ei der Höflichkeit jahrhundertealte Unterdrückung, Ausbeutung, Tyrannei sieht, dann muss man sich an ... einen Arzt wenden“ (Izv., 27.11.91).
Eine tiefgreifende Analyse der semantisch-funktionalen Gründe für die Unzufriedenheit der Gesellschaft mit dem Wort Genosse, wie jedoch bei anderen Appellen im Allgemeinen bei Etiketteformeln der Sowjetzeit, ist in den Werken von N. I. Formanovskaya angegeben (siehe zumindest ihr Buch „Speech Etiquette and Culture of Communication“. M., 1989). Für uns ist es jetzt wichtig, den Geschmack des aktuellen Publikums genau hervorzuheben, der umso einflussreicher ist, je gründlicher er auf die richtigen sprachlichen Faktoren setzt. Separate Abweichungen von der allgemein akzeptierten Vorgehensweise gab es und wird es natürlich immer geben; Unter den Kosaken wird beispielsweise nicht empfohlen, Männer „Muschiks“, „Kameraden“ und „Herren“ zu nennen - sie werden beleidigt sein und als Reaktion auf den geschätzten „Dorfbewohner“ ein stolzes Lächeln verziehen (AiF, 1994, 18).
Wort Herr, der nur als Appell an Ausländer lebte (und natürlich als demütigender Appell an seine Fremden; es ist merkwürdig, dass Kenneth D. Kaunda in einer Rede und verwendete Herr Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets und Genosse Vorsitzender ...- Izv., 23.11.74), begann den Anwendungsbereich schnell zu erweitern. Die neuen Schätzungen wurden zweifellos von der Praxis verschiedener Republiken beeinflusst, die ihre Unabhängigkeit erlangten: Domnule Snegur(Pflichtansprache an den Präsidenten der Republik Moldau und in russischer Sprache. Izv., 22.10.90), Herr Krawtschuk(vgl.: Das Wort „Kamerad“ wurde aus der Charta gestrichen, Soldaten werden aufgefordert, sich gegenseitig anzusprechen, indem sie vor dem Titel das Wort „Pfanne“ hinzufügen: Pankapitän, Pansoldat ... In den Regimentern der ukrainischen Kosaken war dies ein traditionelle Form der Kommunikation.- Izv., 23.5.92) usw. Natürlich spielte auch die allgemeine Neubewertung des vorrevolutionären Lebens in Russland eine Rolle. Von den Adressen entfernt, die dem Russischen entsprechen Genosse, und in den Ländern, in denen sie gepflanzt wurden. So wurde Tong Zhi in China nicht mehr verwendet, in der Tschechischen Republik Soudruh usw.
Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der öffentlichen Unzufriedenheit mit dem System der angenommenen Berufungen, die durch den seit langem heiß diskutierten Aufruf von V. Soloukhin zur Wiederherstellung der Worte belegt wird Herr, Herr, es könne nicht darum gehen, „dem glorreichen Wort „Kamerad“ das gebührende Prestige zurückzugeben, denn „wir sind alle Kameraden, wenn nicht bei der Arbeit, dann bei der Arbeit“ (Izv., 10.3.85). Eine beliebte Propaganda-Erinnerung an Worte Herr, Frau„eine ideologische Konnotation tragen“ und dass sie für die Arbeiter „wie ein Hohn klingen“ (Izv., 1.10.91), verloren alle Beweise und begannen eine Gegenreaktion zu provozieren. Mark Zakharov und Arseny Gulyga gehörten zu den ersten, die sich öffentlich und offen in der Presse dafür aussprachen, dass diese Worte wieder aktiv verwendet werden sollten: Natürlich haben wir keine „Herren“ im alten Sinne des Wortes – Unterdrücker, aber wir haben auch schlimmere Probleme durch „Kameraden“ (wie Stalin) erlitten, die in der Klasse aus demselben Mutterleib waren(LG, 1989, 48).
An den Diskussionen nahm auch Wladimir Soloukhin teil; zufrieden mit der berühmten Wortverbreitung Herr Und gnädige Frau, bemerkte er, dass „es unmöglich ist zu sagen: „Monsieur Petrov kam gestern zu mir“ oder „Madame Ivanova hatte einen Verlust“. In diesen Fällen sollten die Wörter „Meister“ und „Dame“ verwendet werden ... Das Gleiche gilt für den Plural. Es ist nicht ganz richtig zu sagen: „Nun, mein Herr, wie geht es Ihnen?“ Oder um sich an die Versammlung zu wenden: „Sehr geehrte Damen und Herren!“ - es ist verboten. Zuvor sagten sie entweder „Meine Herren!“, Oder „gnädige Herrscher und gnädige Herrscher“ oder „Meine Damen und Herren“. Und wenn es Ihnen nicht gefällt und Sie nicht die Zunge verdrehen, plappern Sie weiter „Kameraden!“ (Izv., 18.10.91)
Diese Erlaubnis wird keineswegs von allen begrüßt, und ein anderer einflussreicher Dichter, Viktor Bukov, schreibt:
Sie haben mich heute angerufen – Sir?
Und am Ärmel gezogen.
Und das Geschirr klirrte im Schrank,
Und der Zucker fiel vom Regal
Sie nannten mich Mr.
Und ich antwortete: - Nicht so!
Und alle Wörter in einem einzigen Kreis
Es ist mir peinlich, diese Lüge zu hören.
Und ich bin immer noch ein Kamerad!
Wie in jenen fernen Jahren.
Du hast es so sehr vergeblich versucht
Melden Sie mich als Gentleman an!
(Bsp. 19.1.94).Die unterschiedlichen Einstellungen zu diesen Worten geben Anlass zur Ironie: Leute (Ihr dürft nicht sprechen Übergangsphase- Genossen oder Herren, das kann von beiden Seiten schlecht eingeschätzt werden), lasst uns ... einen entpolitisierten Staat schaffen(AIF, 1991, 42). Und ohne großen Witz fragen Journalisten: Wie geht es euch, Genossen?(AIF, 1993, 19). Ist dies der Weg zur Rechtsstaatlichkeit, liebe Herren und Genossen?(Izv., 19.5.93). Nein, mein Herr oder Mitbürger, Ihre Überlebenshoffnungen sind illusorisch(Bsp. 16.7.93). Central Radio war konkreter: Es ist gut, dass wir aufgehört haben, Kameraden zu sein, und dass wir gerechte Menschen geworden sind (14.3.93, 11.30).
Es ist merkwürdig, dass die „umgangssprachlich-servile Anrede, Herr Genosse“ kurz nach 1917 erschien und einige Zeit weit verbreitet war (Kartsevsky S. O. Sprache, Krieg und Revolution. Berlin, 1923, S. 18). Heute ist in diesem wiederbelebten Ausdruck eine gewisse Differenzierung spürbar: Herren wird als Berufung angenommen, aber nach dem Wort Kameraden eine gewisse sozialnominative Bedeutung ist festgelegt ( einfache Leute? Arbeitskräfte? vielleicht "Kugeln"?). Orthografisch wird dies durch die Ablehnung der Schreibweise mit Bindestrich bestätigt Kameraden. Dies wird insbesondere in gegensätzlichen Kontexten deutlich: Werden sich die Minister an die Genossen erinnern? ... Es geht uns gut, Genossen ... Die Minister sind unterschiedliche Menschen, sowohl in ihren Ansichten als auch in Bezug auf ihr Einkommen. Meine Herren, Genossen (ich schreibe das Wort „Kamerad“ ohne jede Demütigung - die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bezieht sich auf sie) sind auch verschiedene Menschen ... Wie lebt er, was denkt Herr Genosse? ... Unsere einfachen Herren Genossen sind jetzt zutiefst empört über den Showdown, der in den höchsten Machtebenen stattfindet(RV, 6.8.93). Mit einem Wort, wie der Humorist feststellte, besteht das Problem nicht darin, dass wir Herren geworden sind, sondern darin, dass wir aufgehört haben, Kameraden zu sein!
0,3. Eine weitere anschauliche Darstellung der in der Sprache ablaufenden Prozesse, die es ermöglicht, die dafür verantwortliche Mode zu beurteilen, kann eine Epidemie geografischer Umbenennungen sein. Der Umfang ist so groß, dass eine vollständige Auflistung nicht möglich ist. Im Gegensatz zu den meisten sprachlichen Phänomenen (auch aus den betrachteten Verschiebungen im Adresssystem, die streng genommen spontan entstehen) ist es das Ergebnis einer direkten und bewussten Einflussnahme auf die Sprache, die eine offensichtliche gesetzgeberische Form annimmt.
Beispielsweise wurden durch Beschluss des Moskauer Stadtrats Nr. 149 vom 5. November 1990 ab dem 1. Januar 1991 die folgenden historischen Namen von Plätzen, Straßen und Gassen Moskaus zurückgegeben: Twerskaja Zastava-Platz(Platz des Weißrussischen Bahnhofs), Maroseyka-Straße(Bogdan-Chmelnizki-Str.), Novopeschanaya-Straße(Walter Ulbricht Str.), Sandige 2. Straße(Georgiou-Deja St.), Twerskaja-Jamskaja 1. Straße(Gorki-Straße – vom Majakowski-Platz zum Weißrussischen Bahnhof), Nikolskaya-Straße(25. Oktober St.), Lubjanka-Platz(Dzerzhinsky-Platz), Lubjanka-Bolschaja-Straße(Dzerzhinsky Str.), Kuh Wall Street(Dobryninskaya Str.), Vozdvizhenka-Straße, Neuer Arbat Straße(Kalinina Ave.), Alte Basmannaja-Straße(Karl-Marx-Str.), Myasnitskaya-Straße(Kirow-Str.), Gebiet Sucharewskaja(Kolchosnaja-Bolschaja- und Kolchosnaja-Malaja-Platz), Prechistenka-Straße(Kropotkinskaya Str.), Iljinka-Straße(Kuibyshev Str.), Mokhovaya-Straße, Okhotny Ryad-Straße, Theaterplatz(Marx Ave.), Teiche des Patriarchen(Pionierteiche), Patriarchalische Kleine Gasse(Pionersky Small Lane), Manezhnaya-Platz(Fünfzigster Jahrestag des Oktoberplatzes), Varvarka-Straße(Razina Str.), Theaterplatz(Swerdlow-Platz), Aminevskoe-Autobahn(Suslova Str.), Herbstboulevard(Ustinova Marschall St.), Znamenka-Straße(Frunze Str.), Novinsky Boulevard(Tschaikowsky Str.), Erdschachtstraße(Chkalova Str.).
Mit derselben Entscheidung wurden die Stationen der Moskauer Metro umbenannt: Twerskaja(Gorkovskaya. Dies ist bereits das zweite Mal - durch Umbenennung der Straße), Lubjanka(Dserschinskaja), Alexandergarten(Kalininskaja), Chistye Prudy(Kirowskaja), Sucharewskaja(Gemeinsame Farm), Zarizyno(Lenino), Chinatown(pl. Nogina), Theatralisch(pl. Swerdlow), Okhotny Ryad(pr. Marx), Nowo-Alekseewskaja(Schtscherbakowskaja).
Noch früher wurden in Moskau umbenannt: Ostozhenka-Straße(Metrostroevskaya Str.), U-Bahn-Stationen Chistye Prudy Und rotes Tor(Kirovskaya und Lermontovskaya) und andere. 1993 wurde zum Jahr der Wiederbelebung des historischen Zentrums der Hauptstadt und der Säuberung des toponymischen Bildes seines zentralen reservierten Teils erklärt; Im Frühjahr wurden weitere 74 Straßen, Böschungen und Gassen wieder mit ihren ursprünglichen Namen versehen. Der peppige Ton der Berichte darüber liefert Stoff für die Beurteilung der modischen Beweggründe für die aktuellen Sprachänderungen:
Die bolschewistische Vergangenheit verschwindet endgültig „aus dem Gesicht“ Moskaus. Zum Beispiel ist der Sowjetskaja-Platz jetzt Twerskaja-Platz... Die Gasse des Begründers des sozialistischen Realismus M. Gorki hat wieder den Namen Chitrowski-Gasse erhalten. Jetzt können wir uns besser vorstellen, wo sich die berüchtigte Chitrowka befindet – das berühmte Slumviertel ... Die Uljanowskaja-Straße wurde 1919 zu Lebzeiten des Anführers umbenannt. Wladimir Iljitsch, ein bescheidener Mann, hatte nichts dagegen ... Die ehemalige Nikolaevskaya, die plötzlich eine solche Ehre erhielt, wurde so genannt, weil die Kirche St. Nikolaus der Wundertäter auf den Gruben(AIF, 1993, 20).
Die gleichen Motive durchdringen das Interview des Vorsitzenden der Namenskommission des Moskauer Rates: Während der Jahre der Sowjetmacht verlor die Hauptstadt mehr als tausend ursprüngliche Namen, die unsere Vorfahren jahrhundertelang bewahrt hatten. Manchmal erreichte es einfach den Punkt der Absurdität: Fourth Street am 8. März, Gas Pipeline Street, Lower Knitwear (warum nicht Unterwäsche?). Ist es wirklich angenehmer, an den Pionierteichen entlang zu laufen und dabei vor dem Geist von Pavlik Morozov zu schaudern, als an den Patriarchenteichen entlang? ... Einige Prominente müssen Platz machen. Alexander Sergejewitsch Puschkin hätte sicherlich nie zugestimmt, dass die Weltrarität, die Dmitrowka-Straße, die auf eine sechshundertjährige Geschichte zurückblickt, sicherlich seinen Namen tragen würde. Das Gleiche gilt für Tschechow und Stanislawski ...(Izv., 5.6.93).
Sie fällen den Wald – die Späne fliegen: In der Hitze der Aufregung kommt es nicht einmal dem Kopf in den Sinn, dass es für die nationale Kultur kaum wünschenswert ist, die Erinnerung an Chitrovankas Schlafhütten wiederherzustellen, und selbst auf Kosten des Vergessens berühmter Autor. An der Stelle des Lermontowskaja-Platzes, der Tschaikowsky-Straße und der Chkalow-Straße tauchten alte neue Namen auf, obwohl der Dichter, Komponist und sogar der Pilot sich scheinbar nichts zuschulden kommen ließen und ihr Beitrag zur nationalen Kultur es verdient, in der Toponymie der Stadt verewigt zu werden Stadt.
Die Leidenschaft für die Umbenennung führte sofort zu völlig bedeutungslosen Veränderungen (Savelevsky Lane ist jetzt Pozharsky, Astakhovsky - Pevchesky, Neglinny - Zvonarsky usw.), über die der Feuilletonist E. Grafov schrieb: „Zunächst wurden Marx und Engels in der begraben.“ erste Kategorie. Jetzt wird ihre Straße rachsüchtig Starovagankovsky Lane genannt ... Auch die Bolshevik Lane wurde gestochen. Er soll jetzt Gusjatnikow sein. Und die Komsomolsky Lane mit einer Wendung hieß Zlatoustinsky. Was die nach dem edlen Bolschewisten Stopani benannte Gasse betrifft, so ist sie überhaupt zur Ogorodnaya Sloboda geworden. Offenbar ist dem Moskauer Stadtrat Sarkasmus nicht fremd. Ich behaupte nicht, dass die Nikoloyamskaya-Straße anscheinend viel schöner klingt als die Uljanowsk-Straße. Aber ich versichere Ihnen, es war überhaupt nicht der Uljanow, an den Sie gedacht haben ... Ja, und die Stankevich-Straße kann man im Allgemeinen durchaus Voznesensky Lane nennen. Ja, aber das ist nicht der Stankewitsch, der Stankewitsch ist, sondern ein ganz anderer. Es bestand also kein Grund zur Sorge. Und warum sollte die Serow-Passage in Lubjanski-Passage umbenannt werden? Der Mann leitete den KGB unter großen Schwierigkeiten. Er hat es auf jeden Fall verdient, dass sein Name in der Lubjanka verewigt wird. Dies scheint jedoch nicht derselbe Serow zu sein, sondern ein heldenhafter Pilot. Trotzdem lohnte es sich nicht, das Wort „Lubyanka“ aus den bolschewistischen Jahrhunderten zu extrahieren. Schließlich sprach niemand - sie brachten ihn zum Dzerzhinsky-Platz. Sie sagten, sie seien in die Lubjanka gebracht worden ... Kein Grund, sich mit Umbenennungen verrückt zu machen“ (Izv., 25.5.93).
Eine Gruppe von Schriftstellern und Theaterfiguren (O. Efremov, M. Ulyanov, Yu. Solomin, E. Gogoleva, E. Bystritskaya, Yu. Borisova, G. Baklanov, A.) drückten ihre natürliche Ablehnung der erneuten Begeisterung für die Umbenennung aus. Pristavkin, V. Korshunov, V. Lakshin, I. Smoktunovsky) protestierten an den Vorsitzenden des Moskauer Stadtrats wegen der Aberkennung von Straßennamen wie Puschkinskaja, Tschechow, Stanislawski, Jermolowa, Fedotowa, Nemirowitsch-Dantschenko, Sadowskich aus Moskau , Ostuschew, Juschin, Wachtangow, Moskwin, Katschalow, Chmelev, Gribojedow, Sobinow, Wesnin, Zholtowski, Schtschukin.
Sie schreiben über das von ihm unterzeichnete Dekret: „Es scheint, dass dieses Dokument eine gute Rolle spielen und das kulturelle Image der Hauptstadt von den opportunistischen und ideologischen Verzerrungen vieler Jahrzehnte reinigen soll.“ Doch bereits bei der ersten Lesung wird deutlich, dass wir es mit einem bürokratischen Rundschreiben zu tun haben, dessen Umsetzung zu einem Akt des Vandalismus werden und zu irreparablen Kulturverlusten führen wird … Statt einer vernünftigen Kulturpolitik haben wir es mit … zu tun eine weitere Kampagne unter denen, die uns aus der jüngeren Vergangenheit so vertraut sind... Einen Löwen erkennt man an seiner Klaue. Esel - an den Ohren. Und die Kommunisten von gestern – für senilen Antikommunismus. Nur unaufgeklärte Menschen, die mit Lenins Artikeln aufgewachsen sind und ständig jemanden aufgeweckt haben, können Belinsky, Herzen, Granovsky aus unserem Alltag streichen. Was die Bolschewiki nicht zerstören konnten, versuchten sie sich anzueignen. Und das hatte seine eigene Logik. Gesunder Menschenverstand schlägt eine asymmetrische Antwort vor, weil diese herausragenden Menschen zur gesamten russischen Kultur gehören ... Und der Moskauer Stadtrat vertreibt große Russen und nicht nur Russen (zusammen mit ihnen den Polen Mickiewicz und den Georgier Paliashvili) aus dem Zentrum Moskaus. Es ist notwendig, den Spott über die Kultur zu stoppen, denn Toponymie ist ihr integraler Bestandteil“ (Segodnya, 1.6.93).
Der Prozess der Wiederherstellung alter Namen, Änderungen und Klarstellungen betraf die gesamte russische Toponymie, insbesondere die Namen vieler Städte: Wladikawkas(Ordschonikidse), Wjatka(Kirow), Jekaterinburg(Swerdlowsk), Naberezhnye Chelny(Breschnew), Nizhny Novgorod(Bitter), Rybinsk(Andropow), Samara(Kuibyschew), Sankt Petersburg(Leningrad, Petrograd), Sergejew Possad(Sagorsk), Twer(Kalinin), Scharypowo(Chernenko) usw. (siehe: Moiseev A.I. Nominale Gedenknamen russischer Städte. RYAZR, 1992, 2). Der Prozess erfasste auch nicht-russische Städte – Ukrainisch: Zmiev(Gottwald), Lugansk(Woroschilowgrad), Mariupol(Schdanow); Aserbaidschanisch: Beylagan(Schdanowsk), Ganja(Kirovabad); Georgisch: Bagdadi(Majakowski), Martwili(Gegechkori), Osurgeti(Makharadse); Estnisch: Kuryasaari(Kingisepp) usw.
Beginnend mit der naiven „Estonisierung“ der russischen Rechtschreibung Tallinn(zuvor mit einem N am Ende) ging dieser Prozess in die Richtung, nicht nur unerwünschte Namen, sondern auch russifizierte Formen nationaler Toponyme im Allgemeinen einzuätzen und durch russische Namen zu ersetzen. Beispielsweise wurden durch einen Beschluss des Obersten Rates der Republik Kasachstan Dutzende Toponyme gleichzeitig umbenannt oder „die Transkription auf Russisch angeordnet“: Die Städte Shymkent und Dzhezkazgan wurden Schymkent Und Scheskazgan, die Dörfer Sergeevka, Pugachevo, Luftschiff, Maralikh-Stahl aulami Kainar, Ushbulak, Kyzylsu, Maraldy(Izv., 17.9.92), vgl. Auch Aschgabat(Aschgabat), Tuwa(allerdings mit einer widersprüchlichen Entscheidung, es zu behalten Tuvan, Tuvan- RV, 28.12.93), Halm Tangch(Kalmückien), Mari-el, Sacha(Jakutien).
Sie änderten die traditionelle Form im russischen Alltag in eine Form, die näher an der Landessprache liegt, beispielsweise Namen wie Weißrussland (Weißrussisch, Weißrussisch), Kirgisistan (Kirgisisch, Kirgisisch), Moldawien (Moldauisch, Moldauisch), Baschkyrtostan. Allerdings bestand die Hauptaufgabe in diesem Bereich natürlich darin, unerwünschte Namen zu eliminieren: Bischkek(Frunse), Lugansk(Woroschilowgrad), Mariupol(Schdanow) usw.
Mit freudigem Schalk berichtet der Korrespondent im Artikel „Kiewer Straßen ändern ihren Namen“: Die Hauptstadt der Ukraine verliert rasch die Merkmale der sozialistischen Ära. Die Stadtbehörden genehmigten die neuen Namen von Kiewer Straßen, Parks und U-Bahn-Stationen ... Die meisten Änderungen sind mit der Entfernung von Straßennamen aus dem Stadtplan verbunden, die die Namen von Führern und Anführern der Revolution propagierten. Greifbare „Verluste“ von Wladimir Iljitsch: Die Lenin-Straße wurde in Bogdan-Chmelnizki-Straße umbenannt, der Lenin-Boulevard in Chokolovsky-Boulevard. Die glorreichen Tschekisten haben es auch verstanden. Die Straße unter ihrem Namen trägt jetzt den Namen Hetman der Ukraine Pylyp Orlyk. Andere Namen für die Straßen Oktoberrevolution, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Menzhinsky, Parkhomenko, Korneichuk ...(Izv., 17.2.93).
Im Wesentlichen gibt es in diesem Prozess nichts Neues oder Ungewöhnliches: Erinnern wir uns zumindest daran Zaire, Simbabwe, Kinshasa auf dem Gelände von Belgisch-Kongo, Rhodesien, Leopoldville, einem sehr neuen und weniger verstandenen Elfenbeinküste statt Elfenbeinküste. Politisch-ideologisch begründete Namensänderungen in den ehemaligen RGW-Staaten sind verständlich. Was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist nur das Tempo und Ausmaß des Prozesses, der wie alles andere in Russland so groß ist, dass er auch erfasst wird, was eine Umbenennung nicht zu verdienen scheint. Die Umbenennungskampagne hat etwas Totalitäres, Neobolschewistisches; Merkwürdigerweise tun andere Republiken der ehemaligen UdSSR so, als hätten sie einen Befehl von einer gemeinsamen Mitte erhalten.
Zu dem, was bereits über die Toponymie von Moskau gesagt wurde, können wir die folgenden interessanten und sogar lustigen Fakten hinzufügen. Obwohl die Marine die Umbenennung von Schiffen als schlechtes Omen ansieht, wurden nun die Namen von Kirow, Frunse, Kalinin und anderen sowjetischen Persönlichkeiten sowie die Namen der Hauptstädte der ehemaligen Sowjetrepubliken Baku, Tiflis und anderer durch Eigennamen ersetzt von schweren Flugzeugträgern, U-Boot-Abwehr- und Raketenkreuzern mit den Namen der russischen Admirale Uschakow, Nachimow, Senjawin und auch Peter des Großen. Eine Reihe von Atom-U-Booten erhielten die Namen von Raubtieren: Leopard, Leopard, Tiger, Der andere Teil der U-Boote sind die Namen russischer Städte: Archangelsk, Woronesch, Kursk. Die Schiffe des „Komsomol-Geschwaders“ wurden komplett in Patrouille umbenannt Leningrader Komsomolez, Minensuchboot Nowgoroder Komsomolez usw. (AIF, 1993, 22).
Für die allgemeine Stimmung, für den Moment, der den Geschmack bestimmt, ist es bezeichnend, dass im alten Gebäude der Moskauer Universität in der Mokhovaya-Straße (der ehemaligen Marx-Allee!) wieder das Hauptauditorium aufgerufen wird Theologisch- „Es hieß immer so, bis es in Leninskaya umbenannt wurde“ (Izv., 17.2.93).
Der Umbenennungsprozess ist im Allgemeinen ungleichmäßig, emotional opportunistisch, mit Unterbrechungen und einer sehr schnellen Rückbewegung verbunden. Hier sind zwei typische Meldungen: IN Republik Tschetschenien, wie sie sich jetzt nennt, kam alles anders(Izv., 21.9.92). Nicht Suchumi, sondern Suchumi. Die Sitzung des Obersten Rates von Abchasien ... stellte die Namen der Hauptstadt Abchasiens, der Stadt, wieder her Suchumi und Bergbaustadt Tkuarchal(ab der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre wurden sie auf georgische Weise genannt – Sukhumi und Tkuarchali). Die Siedlung städtischen Typs Gantiadi erhielt einen historischen Ortsnamen Tsandrypsh, Leselidze und Khenvani-Dörfer Aechrypsh und Amzara (Izv., 15.12.92).
Der Wunsch, den Namen phonetisch und/oder buchstabierend näher an die ursprüngliche Schreibweise und den ursprünglichen Klang heranzuführen, ist natürlich und ewig und entfaltet sich mit zunehmender Alphabetisierung, Kultur und gegenseitigem Respekt der Menschen. Es war beispielsweise unmöglich, den postrevolutionären Änderungen in den akzeptierten russischen Formen Tiflis, Wilna, Kowno usw. nicht zuzustimmen. Tiflis, Vilnius, Kaunas(vgl. auch Komi anstatt Zyrianer- Wörtlich „unterdrückt“ die aktuelle Annahme des Formulars Kirgisen In dieser Hinsicht ist es durchaus berechtigt, denn Kirgisisch hat für das kirgisische Ohr unangenehme Konsonanzen).
Auch wenn die oft naiv-sprachliche Wahrnehmung der einen oder anderen Form durch die betroffene fremdsprachige Bevölkerung als grundlegend anerkannt werden sollte. Und es ist nichts Falsches daran, ein Formular fast gesetzlich vorzuschreiben ukrainisch von zwei koexistierenden akzentologischen Varianten, obwohl ich Puschkins Klassiker „Stille Ukrainische Nacht“ nicht korrigieren möchte. Es ist nicht schwer, dem Ungewöhnlichen für Russen zuzustimmen in der Ukraine- So sei es, wenn es jemandem so vorkommt in der Ukraine erinnert demütigend an den Rand, am Stadtrand. Also baten die Chinesen einst darum, zu unterscheiden in Taiwan(auf der Insel) und in Taiwan(in einem von der VR China nicht anerkannten Staat).
Aber es ist unmöglich, hier eine erstaunliche sprachliche Naivität zu erkennen. Zur Zeit des Zusammenbruchs der UdSSR nahmen die politischen und journalistischen Angriffe auf die Form mit zu An. Es wurde auf die heimtückische Wortverwirrung zurückgeführt Ukraine(aus stehlen„vom Ganzen abgeschnitten“) und Stadtrand- mit Bezug auf das Werk von S. Schelukhin aus dem Jahr 1921 „Der Name der Ukraine“, abgedruckt beispielsweise im Almanach „Chronik-2000“ (Ausgabe 2, Kiew, 1992), wo Polen und Russen dies direkt vorgeworfen wird ( Letztere betrachtet der Autor nicht so sehr als Slawen, sondern vielmehr als finnisch-mongolische Stämme. Doch bald tauchten objektive, ruhig vernünftige Stimmen von Linguisten und nicht von Politikern auf, die dazu aufriefen, darin keine große russische Bosheit zu sehen und sich daran zu erinnern, dass die großen Patrioten der Ukraine, insbesondere T. Schewtschenko, es nicht verachteten.
Auf jeden Fall haben die Kiewer Rezensenten der ersten Auflage dieses Buches meiner Meinung nach in der Beurteilung des Russischen (also! Ich habe nicht einmal daran gedacht, zu beurteilen, wie besser es auf Ukrainisch ist) die Verwendung meiner Wörter unangemessen gesehen etwas von meiner Taktlosigkeit. Die russische und die ukrainische Sprache sind eng miteinander verwandt, haben jedoch jeweils ihre eigenen Gesetze und Traditionen. Der Artikel von V. Zadorozhny in der Zeitschrift „Ukrainian Language and Literature in Schools“ (1993, Nr. 5–6), auf den sie sich beziehen, untersucht ukrainische Konstruktionen in der Ukraine - in der Ukraine. Mich beeindruckt übrigens mehr der Artikel von N. Sidyachenko zum gleichen Thema in der Sammlung des Ukrainischen Sprachinstituts der Akademie der Wissenschaften der Ukraine „Kultur des Wortes“ (1994, 45). Und doch, und doch! Offiziell, wenn auch nicht sehr öffentlich, wandten sich die Ukrainer an das US-Außenministerium mit der Idee, das Formular in der Ukraine anstelle des englischen Formulars in der Ukraine zu verwenden – im Wesentlichen mit der gleichen Motivation (das Fehlen des Artikels scheint die Idee zu bestärken). dass wir unseren eigenen Namen haben).
Wenn wir das Pathos der Selbstbestimmung für selbstverständlich halten, dürfen wir unsere Sprache nicht verstümmeln; Man muss verstehen, dass „Souveränität eine Sache ist – eine Tatsache ihrer Geschichte, und eine andere Sache ist ein Name – eine Tatsache unserer Sprache“ (MN, 1994, 1). Nachdem das estnische Parlament die „Estonisierung“ des russischen Namens seiner Hauptstadt erreicht hatte, behielt es den nichtrussischen Akzent im Namen der Hauptstadt Russlands – Moskwa – bei, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es den Namen von Petseri nicht änderte , Pihkva, Irboska, Kaasan, Saraatow nach Petschera, Pskow, Izborsk, Kasan, Saratow.
Das Problem besteht nicht einmal darin, dass die neuen Formen mit einer langen Sprachgewohnheit brechen, sondern dass sie sich für das Ohr der russischen Sprache als ungewöhnlich, schwer auszusprechen und sogar unangenehm erweisen können. Nach k, g, x, Nehmen wir an, es wird nicht s geschrieben und ausgesprochen, weshalb die Schreibweise nicht klingt und nicht „aussieht“ Kirgisistan und unter. Ziemlich sinnlos, denn Russisch kann es nicht so aussprechen, man schreibt auf Russisch zwei Konsonanten am Ende eines Wortes Tallinn, sieht im russischen Text irgendwie ungebildet aus Weißrussland, Weißrussland, Weißrusse. Ähnliche Prozesse sind bei den eigenen Namen zu beobachten: Der Name des ehemaligen Präsidenten Aserbaidschans wird geschrieben Abulfaz Elchibey(traditionelle russische Schreibweise Abulfas; Jetzt treten nicht nur Schwierigkeiten bei der Aussprache eines stimmhaften Lautes am Ende eines Wortes auf, sondern auch die Aussprache der Genitivform und anderer Fälle ändert sich.
Die Tradition steht dem natürlichen Wunsch entgegen, „die Ungenauigkeiten“ eines fremden Namens zu korrigieren, und je älter und stabiler er ist, desto stärker ist sein Widerstand. Das ist wohl kaum der Grund, warum Russen jemals sprechen werden Wette oder die Stadt mit dem antiken Helden verwechseln, Paris anstatt Paris, Rom oder Rum anstatt Rom. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass selbst die Deutschen, beleidigt über die Rolle der UdSSR in der Geschichte, fordern werden, dass wir ihr Land nicht Deutschland, sondern Deutschland nennen! Es scheint, dass Russland aufgehört hat, ausländische Angriffe auf russische Sprachtraditionen bedingungslos hinzunehmen.
Im März 1994 wurde in Radio und Fernsehen mit Unterstützung des Instituts für Russische Sprache der Russischen Akademie der Wissenschaften beschlossen, konsequent zu den bisherigen Namen zurückzukehren: „Keine Sprache kann der russischen Sprache ihre Regeln für Aussprache und Aussprache vorschreiben.“ die Schreibweise von Eigennamen, da sie dadurch erniedrigt und verfälscht wird“ (Pr., 18.3.94). „Die Menschen waren, auch weit entfernt von den Problemen der Linguistik, ratlos, weil sie wussten, dass ein geliehenes Wort in jeder Sprache immer neuen grammatikalischen und Klanggesetzen gehorcht und fast nie in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt.“ Schließlich haben die Briten Russland – Russland, die Franzosen – Russland, die Deutschen – Russland, die Moldauer – Russland, die Inguschen – Rossi. Russische Muttersprachler haben das gleiche Recht, Aschgabat, Alma-Ata und Tschuwaschien traditionell auszusprechen und zu schreiben. Diese Frage hat nichts mit den Problemen der Souveränität und der Achtung der nationalen Würde zu tun“ (MP, 15.3.94).
Es ist jedoch unmöglich, die triumphale Mode und die Stimmung der Menschen nicht zu ignorieren. Man kann nicht umhin, mit der heutigen Vorliebe für Veränderung, für die Ablehnung des Bekannten oder zumindest für die Variabilität zu rechnen: Selbst solche Innovationen, die dem russischen Sprachsystem widersprechen, werden eher akzeptiert als abgelehnt. Auf jeden Fall wäre es lächerlich, sich mit Esten über einen Brief zu streiten, wie es mit den Tschechen und Slowaken der Fall war, deren Meinungsverschiedenheiten über den Bindestrich im Namen des Landes zu einem der Scheidungsgründe wurden. Man sollte auch die riesige russische Diaspora berücksichtigen, die gezwungen ist, die Gesetze des Wohnsitzlandes zu befolgen; Das bedeutet, dass in der russischen Sprache zwangsläufig viele variable Ortsnamen auftauchen. Manchmal muss man sich mit dem naivsten politischen und nationalen Denken abfinden: Es gibt Dinge, die höher sind als die unantastbare Reinheit des literarischen und sprachlichen Kanons.
0,4. Die angegebenen Beispiele ermöglichen es uns, einige theoretische Überlegungen zum Geschmack als Kategorie der Sprachkultur auszudrücken (siehe: V. G. Kostomarov. Fragen der Sprachkultur in der Ausbildung russischer Lehrer. Im Buch: „Theorie und Praxis des Unterrichts der russischen Sprache und Literatur . Die Rolle des Lehrers im Unterrichtsprozess. M., russische Sprache, 1979).
Geschmack im Allgemeinen ist die Fähigkeit zu bewerten, das Verständnis dafür, was richtig und schön ist; Dies sind Leidenschaften und Neigungen, die die Kultur eines Menschen im Denken und Arbeiten, im Verhalten, einschließlich der Sprache, bestimmen. Unter Geschmack kann ein System ideologischer, psychologischer, ästhetischer und sonstiger Einstellungen einer Person oder sozialen Gruppe in Bezug auf Sprache und Sprechen in dieser Sprache verstanden werden. Diese Einstellungen bestimmen die eine oder andere Werteinstellung einer Person zur Sprache, die Fähigkeit, die Richtigkeit, Relevanz und Ästhetik des Sprachausdrucks intuitiv einzuschätzen.
Geschmack ist eine komplexe Verschmelzung gesellschaftlicher Anforderungen und Einschätzungen sowie der Individualität eines Muttersprachlers, seiner künstlerischen Neigungen, seiner Erziehung und Bildung (weshalb der Ausdruck „Geschmäcker sind unterschiedlich“) lautet. Diese Individualität entsteht jedoch auch im Zuge der Aneignung von gesellschaftlichem Wissen, Normen, Regeln und Traditionen. Daher hat Geschmack immer eine konkret-soziale und konkret-historische Grundlage; daher spiegelt der Geschmack, der sich individuell manifestiert, in seiner Entwicklung die Dynamik des gesellschaftlichen Bewusstseins wider und vereint die Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft in einem bestimmten Stadium ihrer Geschichte (nicht umsonst spricht man vom Geschmack einer Gesellschaft und einer Epoche). .
Die wichtigste Geschmacksbedingung ist sozialer Natur und wird von jedem Muttersprachler aufgenommen, das sogenannte Gefühl oder die Intuition der Sprache, die das Ergebnis von Sprache und allgemeiner sozialer Erfahrung, der Aneignung von Sprachkenntnissen und Wissen darüber ist die Sprache, die unbewusste Einschätzung ihrer Tendenzen, die Wege des Fortschritts. Mit den Worten von L. V. Shcherba: „Dieses Gefühl ist bei einem normalen Mitglied der Gesellschaft sozial gerechtfertigt, da es eine Funktion des Sprachsystems ist“ (L. V. Shcherba. Über den dreifachen Aspekt sprachlicher Phänomene und über das Experiment in der Linguistik. Im Buch: „Sprachsystem und Sprachaktivität“, L., 1974, S. 32). Das Gespür für Sprache selbst ist eine Art System unbewusster Bewertungen, das die systemische Natur der Sprache in der Sprache und soziale sprachliche Ideale widerspiegelt.
Ein Sprachgefühl bildet die Grundlage für eine globale Einschätzung, Akzeptanz oder Ablehnung bestimmter Entwicklungstrends, bestimmter Wortschatzschichten, für die Beurteilung der Angemessenheit bestimmter stilistischer und allgemein funktional-stilistischer Spielarten der Sprache unter den vorherrschenden Bedingungen und für diese Zwecke. In diesem Sinne ist es stark abhängig von den systemischen und normativen Merkmalen der Sprache, von ihrem „Geist“ und „Eigensinn“, ihrem Ursprung, ihrer Geschichte und ihren Fortschrittsidealen, akzeptablen und wünschenswerten Bereicherungsquellen, der Originalität ihrer Struktur und Komposition. Nehmen wir also an, die Flexion, der formale Ausdruck von Zusammenhängen in einem Satz, macht den Sinn der russischen Sprache viel intoleranter gegenüber einem Haufen identischer Formen als Englisch oder Französisch, weshalb beispielsweise aufeinanderfolgende Konstruktionen mit of oder de zulässiger sind als russische Genitivfälle (außerhalb begrenzter Spezialbereiche, siehe O. D. Mitrofanovas Arbeiten zur „wissenschaftlichen Sprache“).
Aufgrund der Besonderheiten der russischen Grammatik erweist sich die russische Sprache hinsichtlich Intonation und Wortstellung als flexibel und vielfältig, was wiederum die Möglichkeiten der ausdrucksstarken tatsächlichen Artikulation von Aussagen vielfältiger macht. Homonymie ist für ihn schwach charakteristisch, weshalb Russen übrigens gerne danach suchen und darüber stolpern, obwohl Mehrdeutigkeiten natürlich normalerweise leicht durch den Text ausgelöscht werden.
Die Zusammensetzung der russischen Sprache sowie ihre Struktur beeinflussen den Geschmack. Somit verändert jeder neue Blick auf die historische Korrelation der altslawischen Alphabetisierung und des ursprünglichen ostslawischen Volksspracheelements unsere stilistischen Vorstellungen erheblich. Slawismen sind einerseits organisch Teil der Literatursprache, andererseits wurden sie jahrzehntelang als schwerfällige und pompöse, oft lächerliche Archaismen wahrgenommen. Mit einer Änderung der Ziele im Sprachgebrauch und der Entstehung ihrer neuen Funktionen, die durch eine veränderte Haltung gegenüber der orthodoxen Kirche, gegenüber der Religion im Allgemeinen, zum Leben erweckt werden, verändert sich auch die Haltung gegenüber den alten (kirchlichen) Slawismen dramatisch.
Hin und wieder sind Folklorepoetik, dialektale Gegensätze von Nord und Süd, mittelalterliche „Wortweberei“, Geschäftssprache und urbane Koine, die auf Moskauer Orden zurückgehen – Umgangssprache, Zuflüsse deutscher, französischer und heute amerikanischer Fremdheit – am häufigsten vertreten vielfältige Phänomene verschiedener Stadien der Geschichte der russischen Sprache.
Die Auseinandersetzungen zwischen „Schischkowisten“ und „Karamsinisten“, „Slawophilen“ und „Verwestlern“, ganz zu schweigen von der synthetischen Tätigkeit des Begründers der modernen Literatursprache A. S. Puschkin und anderer Klassiker des 19. Jahrhunderts, sind lebendig und in vielerlei Hinsicht lehrreich der heutige Geschmack. Kulturelles und nationales Gedächtnis spiegelt sich im Flair der Sprache wider, Schichten unterschiedlicher Erbes, unterschiedlicher Poesie- und Sprachkonzepte lösen sich auf. Eine wichtige Rolle bei der Bildung des Sinns und Geschmacks der russischen Sprache spielte und spielt das Verhältnis von Buch- und Nichtbuchsprache, das oft den Charakter einer Rivalität zwischen Literatur- und „Volkssprache“ annimmt.
IN Sowjetzeit Hohe Entwicklungsraten und abrupt wechselnde Geschmäcker haben einen erheblichen Bestand an heterogenen Veränderungen und Deformationen angesammelt, die heute, mit Beginn der postsowjetischen Ära, auf die Probe gestellt und neu bewertet werden. Dementsprechend ist nun mit einer Suche nach „frischem“ sprachlichem Material, einer Neuverteilung stilistischer Schichten, einer neuen Synthese von Ausdrucksmitteln zu rechnen (und das konkrete Material der Folgekapitel bestätigt dies).
Geschmack ist also im Wesentlichen ein wechselndes Ideal des Sprachgebrauchs entsprechend dem Charakter der Zeit. „Allgemeine Normen des Sprachgeschmacks“, die mit der Sprache des Schriftstellers übereinstimmen oder nicht, liegen laut G. O. Vinokur „auf der Brücke, die von der Sprache als etwas Unpersönlichem, Allgemeinem, Überindividuellem zur eigentlichen Persönlichkeit des Schriftstellers führt.“ Schriftsteller“ (G. O. Vinokur, „On the Study of the Language of Literary Works“, „Selected Works on the Russian Language“, Moskau, 1959, S.
Geschmack verliert oft seine historische Gültigkeit und folgt opportunistischen, zufälligen Bestrebungen. Dann wird es geschmacklos. Er verliert dann sogar die natürlich vermittelte Verbindung zum gedanklich-inhaltlichen Aspekt der Kommunikation und zum natürlichen ästhetischen Begrenzungsrahmen. Mit anderen Worten: Geschmack erscheint als die Extreme der Mode. Die Sprache verlässt in diesem Fall den Bereich zwischen dem „unerreichbaren Ideal“ und „noch kein Fehler“, verliert die wertenden und geschmacklichen Qualitäten der „guten Sprache“ (siehe: B. N. Golovin. Grundlagen der Theorie der Sprachkultur. Gorki, 1977; N. A. Plenkin, Kriterien für gute Sprache, Russische Sprache in der Schule, 1978, 6). Mit Blick auf die Zukunft stellen wir fest, dass eine Qualität „guter Sprache“ wie Frische, d. h. der Wunsch, bekannte Ausdrucksmittel und Ausdrucksweisen auf den neuesten Stand zu bringen, für unsere Zeit besonders relevant ist.
Bei allem natürlichen Wunsch, den Geschmacksbegriff als kultursprachliche Kategorie zu objektivieren, kann man ihm natürlich auch seine subjektive Individualität nicht absprechen. Ohne diesen Gedanken jetzt weiterzuentwickeln, wollen wir nur die merkwürdigen Überlegungen eines prominenten modernen Dichters und Schriftstellers zitieren: „Man kann einer Blume keine Schraube in Form eines Zusatzes anhängen.“ Es ist unmöglich, Büroklammern in Form von Anhängern an einer Perlenkette am Hals einer Frau zu befestigen. Man kann dem Wort „Palast“ nicht das Wort „Ehe“ hinzufügen. Es ist auch nicht zu erklären, warum dies nicht möglich ist. Es kommt auf das sprachliche Hören, auf den Geschmack, auf das Sprachgefühl und letztlich auf die Ebene der Kultur an“ (V. Soloukhin. Herbstlaub).
Die Qualitäten „guter Rede“ sind relativ, manchmal sogar in sich widersprüchlich – und das nicht nur wegen ihres allgemeinen subjektiven Geschmackscharakters und ihrer engen Abhängigkeit von der im Einzelfall ausgedrückten konkreten Bedeutung, von den Bedingungen und Zielen eines gegebenen kommunikativen Aktes, aber vor allem wegen des strikten Determinismus jeder Rede durch die in der Literatursprache verfügbaren Normen. Allerdings erweisen sich diese normativen Ausdrucksmittel und die etablierten Methoden ihrer Verwendung bei typischen Inhalten, in inhaltlich, ziel- und bedingungsähnlichen Äußerungen in der aktuellen Situation sehr oft nicht als dem neuen Geschmack entsprechend und werden konsequent überarbeitet.
Ende des Einführungsabschnitts.
Doktor der Philologie, Professor, Präsident des Staatlichen Instituts für Russische Sprache. A. S. Puschkin
Geboren am 3. Januar 1930 in Moskau. 1952 schloss er sein Studium als externer Student an der Russischen Abteilung der Philologischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität ab. M. V. Lomonosov, 1953 - Englischabteilung der Übersetzungsabteilung des Moskauer Instituts für Fremdsprachen. 1955 erhielt er einen Doktortitel (Aufbaustudium am Institut für Linguistik der Akademie der Wissenschaften der UdSSR), 1969 einen Doktortitel in Philologie (Fakultät für Journalismus der Moskauer Staatlichen Universität). Ordentliches Mitglied der Russischen Akademie für Pädagogik (bis 1991 Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der UdSSR).
Er arbeitete an der Höheren Parteischule des Zentralkomitees der KPdSU als Übersetzer, dann als Lehrer und Leiter der russischen Sprachabteilung bis 1964, danach leitete er zwei Jahre lang den Bereich Sprachkultur des Russischen Sprachinstituts der KPdSU Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Derzeit ist er Präsident des nach V.I. benannten Staatlichen Instituts für Russische Sprache. A. S. Puschkin (bis 1971 Wissenschaftliches und Methodisches Zentrum für Russische Sprache als Teil der Moskauer Staatlichen Universität, benannt nach M. V. Lomonosov). 1990-1992 wurde zum Präsidenten der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der UdSSR gewählt.
V. G. Kostomarov gehört zur Sprachschule des Akademikers V. V. Vinogradov und beschäftigt sich mit dem Studium der modernen russischen Stilistik und Lexikologie, Trends in der Entwicklung der russischen Sprache, die vor allem im Bereich der Massenmediensprache zu finden sind (Bücher „Kultur der Sprache“) und Stil“, „Russische Sprache auf einer Zeitungsseite“, „Sprachgeschmack der Zeit“, „Unsere Sprache in Aktion“). In Zusammenarbeit mit E. M. Vereshchagin untersuchte er die Beziehung zwischen Sprache und Kultur und begründete eine besondere wissenschaftliche Richtung – die Lingukulturologie (die in sechs Auflagen erschienenen Bücher „Sprache und Kultur“, „Sprach- und Kulturtheorie des Wortes“ usw.). Er interessierte sich auch für soziolinguistische Probleme, den Platz und die Rolle der russischen Sprache unter anderen Sprachen (die Bücher „Das Leben einer Sprache“, „Die russische Sprache unter anderen Sprachen der Welt“). Im Dienst beschäftigte er sich mit Linguodidaktik (gemeinsam verfasste Bücher „Methodischer Leitfaden für Lehrer der russischen Sprache für Ausländer“, „Methoden zum Unterrichten von Russisch als Fremdsprache“ sowie eine Reihe von Lehrbüchern, vor allem „Russische Sprache für alle“. “, der 14 Auflagen erlebte und 1979 verliehen wurde Staatspreis DIE UDSSR). Die Gesamtzahl der Veröffentlichungen übersteigt 600. Unter der Leitung von VG Kostomarov wurden 56 Doktor- und Masterarbeiten verteidigt. Chefredakteur der Zeitschrift Russian Speech, Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Russian Language Abroad.
Seit der Gründung der Internationalen Vereinigung der Lehrer für russische Sprache und Literatur wurde er als Generalsekretär und Präsident in deren Führung gewählt und ist derzeit zum Vizepräsidenten gewählt.
Verdienter Wissenschaftler Russische Föderation, Träger des russischen Präsidentenpreises im Bildungsbereich, Träger in- und ausländischer Auszeichnungen, Ehrendoktor einer Reihe von Universitäten.
M.: Indrik, 2005. - 1038 S. Qualität: Gescannte Seiten + Schicht erkannten Textes In dieser grundlegenden Monographie fassten die Autoren ihre fast vierzigjährigen Recherchen zusammen. Die Studie besteht aus 3 Abschnitten, 12 Teilen, 56 Kapiteln. Erstmals wird im Buch das sprachwissenschaftliche Verständnis des zentralen Sprachproblems – der Beziehung zwischen Sprache und Kultur – ganzheitlich und umfassend dargestellt. Das vorgeschlagene philologische Werkzeug ermöglicht es Ihnen wirklich, die nationale Kultur durch Sprache und Texte zu objektivieren und die Besonderheiten der Semantik der Sprache im Hinblick auf die Entstehung und Funktionsweise der Kultur zu erfassen. Inhalt:
Einführung
Abschnitt eins. Aspekt der Statik: Sprache als Träger und Quelle nationalkultureller Informationen
Nominativeinheiten der verbalen Sprache
Wort: Korrelation von Inhalts- und Ausdrucksebenen
Das Konzept ist: Es gibt kein Token
Ein Konzept – mehrere Lexeme
Es gibt ein Lexem – es gibt kein Konzept
Ein Lexem – mehrere Konzepte
Lexikalisches Konzept und interlinguale (ohne) Äquivalenz
Lexikalischer Hintergrund und interlinguale unvollständige Äquivalenz
Allgemeine Beschreibung des Phänomens „lexikalischer Hintergrund“
Kurz über nominative und relationale Spracheinheiten
Lexikalischer Begriff und begriffliche Nichtäquivalenz
Lexikalischer Hintergrund und unvollständige Hintergrundäquivalenz
Klassifizierung von nicht äquivalentem und nicht äquivalentem Vokabular
Ausflug
LF Historismus Artel
Hintergrundmerkmale des terminologischen Vokabulars
Hintergrundmerkmale des onomastischen Vokabulars
LFon-Eigenschaften
Kumulative Funktion
Wortbildung und metaphorische Ableitung
Schlussbemerkungen
Möglichkeiten zur Objektivierung lexikalischer Hintergründe
Sinnhaftigkeit der Kommunikation
Kommunikation als Wissenstransfer
Entstehung und Migration semantischer Teile des lexikalischen Hintergrunds
Sprachliche und regionale Interferenz und Vergleich lexikalischer Hintergründe
Soziale Dynamik von Lfons
Anteile am individuellen Bewusstsein
Visuelles Bild als Teil des Lfon
Nationalkulturelle Semantik der russischen Phraseologie
Klärung des Konzepts der Ausdruckseinheit
Nominative Semantik des Phraseologismus: endgültige Definition
Biplanare Semantik des Phraseologismus: Phraseologischer Hintergrund
Nationalkulturelle Semantik des Phraseologiehintergrunds
Ausflug
Metapher als Ausdrucksmittel: Linie ziehen, abhaken, rotes Licht einschalten, in die Umlaufbahn bringen
Nationalkulturelle Semantik sprachlicher Aphorismen
Klärung des Konzepts des sprachlichen Aphorismus
Aphoristisches Sprachniveau
Biplanare Semantik des Aphorismus: aphoristischer Hintergrund
Nationalkulturelle Semantik des aphoristischen Hintergrunds
Kumulative Funktion
Direktive Funktion
Verwendung und Modifikation von Sprachaphorismen in der Sprache
Wortschatz, Phraseologie, Aphoristik als sprachliche und kulturelle Quellen
Die Struktur der Semantik der Nominativeinheit der Sprache
Sprachliche und regionale Semantisierung von Hintergründen
Sprach- und Kulturwörterbücher der Phraseologie und Aphoristik
Gruppenmethoden der Hintergrundsemantisierung
Motivierte abschließende Benennung des genannten Konzepts
„Gelegentliche“ Markierungen im „Wörterbuch der russischen Sprache“ von S. I. Ozhegov
Bestimmung des Stellenwerts von nichtäquivalentem Vokabular und Hintergrundvokabular in der modernen russischen Literatursprache
Das kontinische Konzept in der konkreten synchronen Analyse: Puschkins russischer Mephistopheles
Puschkins Mephistopheles ist nicht Goethes Mephistopheles
Anwendung des LFon-Konzepts auf spezifische Analysen
Berechnung der Hintergrund-SD-Anteile des Lexems bes und konjugierter Wörter in Puschkins Werken
Systematisierung der Hintergrund-S-Anteile des Lexems bes
Vergleich des P-Kalküls mit den aus den Evangelientexten extrahierten S-Teilen
Vergleich der P-Kalküle mit S-Anteilen aus Folkloretexten
Der Dämon in Lermontovs gleichnamigem Gedicht ist nicht der Dämon des Evangeliums und der Folklore
Das kontinische Konzept in konkreten diachronen Suchen
Leben, Bauch, Zhitik
Ruhm
Stoud
Adams Bild
Heilige Sekunde
Anhang 1 (zu Unterkapitel OZ-5). Sprach- und Regionalarchäologie: ein Viertel und ein Viertel in Russland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Anhang 2 (zum Futter 03-5). Sprach- und Kulturarchäologie: Aktivist und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in der Sowjetzeit
Anhang 3 (für Soße 03-5). Sprach- und Regionalarchäologie: Was 1985 einem sowjetischen Lehrer selbstverständlich erschien und einem Lehrer aus Deutschland unverständlich war
Anhang 4 (für Soße 03-7). Das Bild des Heiligen, wie er durch den Hintergrund mit Kommentar zu seinem Namen offenbart wird
Anhang 5 (für Soße 13-4). Schlage alles hart und läute alle Glocken
Anlage 6 (zu Naht 17). Molech im Tanakh, im Gegensatz zu Puschkins Milch
Berechnung der Hintergrund-S-Anteile
Anlage 7 (zu Naht 17). Puschkin, Rilke und das Problem der Korrelation zwischen nationaler Kultur und suprakultureller Zivilisation
Erste Beobachtung
Zweite Beobachtung
Allgemeine Schlussfolgerung
P. Relationale Einheiten der verbalen Sprache als Träger und Quellen national-kultureller Informationen
Russische Phonetik und Intonation als Phänomen der nationalen Kultur
Wortbildung, Morphologie und Syntax als Phänomen der Nationalkultur
Sh. Nationale und kulturelle Originalität der russischen Literatursprache als Ergebnis des Zusammenspiels zweier Elemente
A. S. Puschkin als Historiker und Schöpfer der russischen Literatursprache
A. S. Puschkin zur Geschichte der russischen Literatursprache
Die Lehre von den „zwei Elementen“ in der Formation
und Entwicklung der russischen Literatursprache
Ausflug
Puschkin liest Swjatoslaws Isbornik 1073
Ausflug
Puschkin interpretiert „Die Geschichte von Igors Feldzug“
Durchbruch der russischen Sprache in der Petruszeit
Rolle der Russischen Akademie
Puschkin als Schöpfer der modernen russischen Literatursprache
Die Rolle des populären umgangssprachlichen Elements
Die Rolle der buchslawischen Elemente
Die Gefahr der Gallomanie
Ausflug
Makkaronische Poesie von Ishka Myatlev
Die Gefahr von Salonsprache und Affektiertheit
Synthese volkstümlicher umgangssprachlicher und buchslawischer Elemente in der Sprache Puschkins
Ex-Kurs
Puschkin und die Bibel
Anhang 1 (zu Unterkapitel 02-5). Zwei Übersetzungen aus dem Kirchenslawischen ins Russische
Fastengebet des Syrers Ephraim und Vaterunser
Anhang 2 (zu Unterkapitel 02-5). „Das Krallentier, das das Herz aufkratzt“ – Gewissen
Nonverbale Sprachen als Sprecher
und Quellen national-kultureller Informationen
Russische somatische Sprache
Schicht somatischer Äußerungen auf Russisch
Derselbe Somatismus kann durch unterschiedliche Äußerungen ausgedrückt werden
Ein und dieselbe Äußerung kann verschiedene Somatismen bezeichnen
Sprache kann nicht die Form, sondern die Bedeutung des Somatismus widerspiegeln
Somatismen werden durch Äußerungen unterschiedlicher Explikationsgrade ausgedrückt
Die eidetische Sprache vermittelt die Bedeutung des Somatismus vollständig
Universalisierung und Phraseologisierung somatischer Phrasen und Probleme der linguistischen und regionalwissenschaftlichen Semantisierung
Sprache ist das Haus des Seins? Genesis – das Haus der Sprache?
Verallgemeinerung des LFon-Konzepts
Lexikalischer Hintergrund: A-priori-Ansichten
Komponentenanalyse der Semantik eines Hauses, der Wohnung einer Person: Berechnung des Hintergrunds S Anteile von sieben Lexemen (Dach, Wand, Fenster, Tür, Veranda, Schwelle, Ecke)
Dach, Dach, (bei) Dach
Wand (zu Hause)
Fenster (zu Hause)
Eingang zur Wohnung: Tür
Eingang zur Wohnung: Schwelle
Mindestraum im Haus: Ecke (nicht berechnet)
Verallgemeinerung von Rechenverfahren
Identifizierung von Hintergrund-SDs
Erstellen einer Freigabeliste
Ganzheitliche Analyse der Semantik eines Hauses, der Wohnung einer Person: Berechnung von Hintergrund-S-Anteilen
Religiöse Vorstellungen über das Haus, die Wohnung
Haus, Wohnung als solche
Traditionelle russische Wohnung
Wohnen in Russland im 19.-frühen 20. Jahrhundert. (SD nicht berechnet)
Wohnen in Soviet Russland(1917-1991) (SD nicht gezählt)
Wohnen im postsowjetischen Russland
Lexikalischer Hintergrund: A-posteriori-Beobachtungen
Das letzte Mal über die Struktur des Wortes
Kumulative Sprachfunktion
Individuelle und soziale Aspekte des Kommunikationsprozesses
Monosemie von Reden in einem kommunikativen Akt
Zwei Arten der Kommunikation – pragmatisch und metallinguistisch
Komprimierung metalinguistischer Texte im Entstehungsprozess des LFon
Entstehung und ursprüngliche Zugehörigkeit von Hintergrund-SDs
Soziale Dynamik des LFon
Die Natur des Seins S Anteile im individuellen Bewusstsein
Exoterische und esoterische S-Teile
Abschnitt zwei. Aspekt der Dynamik: Text als Träger und Quelle nationaler kultureller Informationen
Text als eine Reihe national-kultureller Sprachverhaltenstaktiken
Einleitende Bemerkungen
Delikt: Rechtfertigung und Entschuldigung nach J. Austin
RP-Taktik: Induktive Beschreibung des Konzepts
Der soziale Charakter der RP-Taktik und die Reden, die sie umsetzen
Nationale und kulturelle Besonderheiten von RPTaktiki
und die Reden, die es umsetzen
Moralisch unbezahlbare (weltliche) Auslöschung der Straftat
allgemeine Informationen
A. Sechs Sprechverhaltenssituationen; aufschlussreiche Sprüche
B. Metaphorische Vorstellungen über Weindelikt
-1V. Nonverbale Existenz von RP-Taktiken und ihre verbalen Umsetzungen
D. Konstrukte und dreistufige Verteilung von RPTaktik
E. Perlokutionärer Effekt und illokutionäre Ziele
Eine Reihe von Taktiken zur Selbsterkenntnis der Schuld
A. PTactic Direct Pleading Group
B. Gruppe RPTaktik zur Minimierung von Delikten
B. Gruppe RPTaktik Verschlimmerung der Straftat
Die RP-Taktik des erzwungenen Schuldgeständnisses
-HINTER. True Accusation Tactics Group
-ZUM BEISPIEL. Gruppe für falsche Tadeltaktiken
ZV. Gruppe RPTaktik akzeptiert den Vorwurf nicht
Der Satz von RP-Taktiken der freiwilligen Entschuldigung (nicht berechnet)
Der Satz von RP-Taktiken der erzwungenen Entschuldigung (nicht berechnet)
Der Satz von RPTaktik akzeptierte eine Entschuldigung (nicht berechnet)
Der Satz von RP-Taktiken der abgelehnten Entschuldigung (nicht gezählt)
A. RPTactic-Kommunikationsgruppe
B. RPTaktik-Kommunikationsgruppe
Auswahl einer Reihe von RPTactics je nach Strategie
Moralisches und vorurteilsfreies Bild zweier Kommunikanten in der Omnikularwelt
Moralische Einschätzung von Entschuldigung und Konfrontation in einer Welt mit einer spirituellen Dominante
Ausflug
Die Lehre vom Numinosen in Religion und Ideologie (R. Otto)
Ausflug
Die Lehre vom Zusammenhang von Religion und Ideologie (P. Tillich)
Auslöschung der unerlaubten Handlung aus der Position der sanften Ethik
RP-Taktik in der Bußdisziplin der Kirche und in der Aufklärungsarbeit der Partei
Berechnung der konfessionellen und pädagogischen RPTaktik
Gebote und Verbote in der Abstinenzethik
Der Status der Gerechten
Beseitigung der unerlaubten Handlung unter dem Gesichtspunkt strenger Ethik
Der Dreiklang von ethischen Bewertungen und dem Ideal der Heiligkeit
RP-Taktiken, ermittelt durch Prolog-Analyse
RP-Taktiken, erhalten durch die Analyse von Ktitor-Chartas
RP-Taktiken, die durch historische Analyse eines semantisch-verhaltensbezogenen Paradigmas gewonnen wurden: èXeyxeiv u exponieren
Ideologisch motivierte strenge Ethik
Sprachliche und regionale Archäologie: Berechnung der RPTaktik der Warteliste
Wörterbuch und alltägliche Definitionen
Strategien im Verhalten der Masse der Menschen auf der Warteliste
RP Verhaltenstaktiken in der Masse
RP-Taktiken des individuellen Verhaltens
Beispieldiskurs in der Warteschlange
Kollisionen in der Warteschlange
Dynamische Berechnung von RPTactics: Unvollendete Veränderungen in der Einstellung der Russen zum Geld
Zwei anschauliche Beispiele und eine Problemstellung
Gruppe RPAktik „Geld ist (nicht) alles in unserer Welt“
Weitere Beispiele des RPTactic-Kalküls
Ein Aufruf zur Offenheit (basierend auf der russischen Kultur)
RP-Taktiken zur Aufforderung zur Offenheit: Ein Versuch, Redewendungen kontrastiv zu durchdringen Sprachverhalten
A. Anschauliche Beispiele und Problemstellung
B. Analyse des Konzepts der „Offenheit“
B. Die Superaufgabe „Aufforderung zur Offenheit“ und die RPT-Taktiken, die sie umsetzen
D. Pragmatische Charakterisierung des „Aufrufs zur Offenheit“
Der Ort der wichtigsten Aufgabe, RPTaktik und Repliken in der Dialogstruktur
Gegenseitige hierarchische Stellung der Sekretärin und der Vertrauensperson
Die typischsten Kommunikationssituationen bei der Softwareimplementierung
Software-Endziele
E. RP-Taktiken zur Forderung nach Offenheit: Sprachmaterial
Elementares TPO
TPO reduzieren und konkretisieren
Sanfte (oder beruhigende) TPOs
Harte (oder bedrohliche) TPOs
E. Einige Ergebnisse der kontrastiven Analyse
Pessimistische Warnungen und Prognosen
Gefahr
Schlussbemerkungen
Anhang 1 (Superkapitel 04-4). Berechnung der RP-Taktik der Troparia des ältesten Kanons
St. Demetrius von Thessaloniki
Anhang 2 (zu Kapitel 5). „Sie haben sich mit einem versteckten Kreuz signiert“: RPT-Taktik sowjetisch-orthodoxer Krypto-Christen
Anlage 3 (zu Naht 6). „Wir scheuen uns nicht vor Äußerungen“: Russische Obszönitäten und die Kultur der Unterseite
P. Erzähltext in sprachwissenschaftlicher und regionaler Betrachtung
Pragmatische und projektive Texte
Pragmatischer Text
projektiver Text
Über Subtext und Kontext
Über Subtext und Subtext
Über die Handlung und Absicht
Sprachkommentar
Die erste Art sprachlicher und kultureller Kommentare: pragmatisch
Die zweite Art sprachkultureller Kommentare: projektiv, kontextorientiert
Die dritte Art des sprachkulturellen Kommentars: projektiv mit Fokus auf den Text
Sprachliche und regionale Lektüre: pragmatische und projektive Texte im Zusammenhang
Sprachliche und regionale Entwicklung von Kunstwerken
Was ist ein Pflichtkunstwerk?
Leitende Methode der sprachkulturellen Entwicklung von Kunstwerken
Die erste Technik der suggestiven Methode: Isolierung der Hauptbedeutung des künstlerischen Bildes
Der zweite Trick der suggestiven Methode: projektive Indikatoren an die Hauptbedeutung anhängen
Der dritte Trick der suggestiven Methode: Sich auf die Hauptbedeutung einstimmen
Die vierte Technik der suggestiven Methode: Stärkung projektiver Indikatoren
Noch einmal über die Rolle der Philologie in der Sprach- und Landeskunde
Belletristiktext: Analyse durch Calculus RPTactics
Berechnung gemäßigter (abstinenter) Sprechverhaltenstaktiken
in der Geschichte von A. S. Puschkin „Der Bahnhofsvorsteher“
Vielfalt der Interpretationen
Rekonstruktion der Geschichte der Geschichte durch Literatur
Klärung der Absicht des Autors
Analyse des Sprachverhaltens von sechs Charakteren der Geschichte
Kurze Wiedereinführung des Konzepts der Sprechverhaltenstaktik
RP-Taktik von Samson Vyrin
Ausflug
Wie viel wollte der Kapitän auszahlen?
Ausflug
Samson Vyrin oder vielleicht doch Simeon
RPtaktiken von Kapitän Minsky
RP-Taktik eines deutschen Arztes
RP-Taktik des betrunkenen Kutschers
RP-Taktik der „Frau des Brauers“
RP-Taktik der „roten und krummen“ Vanka
Textsorte Gleichnis; gemäßigte (Entzugs-)RP-Taktik
Genremerkmale des Gleichnisses
Das Konzept der abstinenten (zurückhaltenden) RP-Taktik
Ausflug
Warum wollte Silvio nicht schießen?
Sprachverhaltensparadigma im Gleichnis vom verlorenen Sohn
Avdotya Samsonovnas abstinente RP-Taktik und ihre Bedeutung
Lebens(un)erfolg als Anreiz zur Reue
Ausflug
Puschkins Auszug aus dem Leben von John Kuschnik
Der Zeitpunkt der Reue als Verhaltensparadigma im Gleichnis vom verlorenen Sohn
Puschkin als Vertreter der neutestamentlichen Ethik
Abstinente Taktiken von Avdotya Samsonovna, die nicht mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn verbunden sind
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, angewendet auf Puschkin selbst
Schlussbemerkungen
Einzigartige Sprachverhaltenstaktiken in B. Sadovskys Versgeschichte „Fedya Kosopuz“
Analyse der poetischen Erzählung von B. Sadovsky „Fedya Kosopuz“ und Definition grundlegender Begriffe
Was fielen anderen in Fedyas Augen auf?
Definition eines Begriffsnests mit Bezugswort Singular
Was fiel anderen auf, als Fedya sprach und Dinge tat?
Was fiel anderen auf, als Fedya nichts sagte und nicht handelte?
Verstöße gegen die Verhaltensnorm als Reiz und Inhalt singulärer Sprache
Syllogismus als logische Natur der singulären Sprache
Aufdeckung der Kausalität als ultimatives Ziel singulärer Aussagen
Ausflug
Beweis eines alttestamentlichen Sprichworts
Inkonsistenz bei der Einschätzung der Verhaltensnorm
Berechnung singulärer Sprachverhaltenstaktiken
Künstlerischer Text
in einer umfassenden sprach- und regionalwissenschaftlichen Studie
„Borodino“ von M. Yu. Lermontov in sprachlicher und regionaler Betrachtung
„Auf dem Kulikovo-Feld“ von A. A. Blok in sprachlicher und regionaler Betrachtung
„Matrenin Dvor“ von A. I. Solschenizyn in sprachlicher und regionaler Betrachtung
Das Problem des nationalen Ideals
Das Problem der nationalen Selbstkritik
Oh, vielleicht, irgendwie
„Hohe Erfolgsquote“
dritte. Synthese von Statik und Dynamik: die Spekulation eines Sapientema
Vorläufige Ansätze zum Konzept des Sapientema
Erster vorläufiger Ansatz: Cogito, erçjosapienteme est
Ol
Von der Intuition zum Diskurs: zur Art der Darstellung
Propädeutische Demonstration der Intuition über Sapientema
Kosmogonische Nominierungen Leben
Der zweite vorläufige Ansatz: Latenz in der Sprachproduktion als Beweis für deren Nonverbalität
Klärung der Terminologie
Grammatik analysieren
Grammatik synthetisieren
Schöpfungsgrammatik
Simulation der Spracherzeugung
Der latente Prozess der Spracherzeugung: Bewusste Mechanismen
Der latente Prozess der Spracherzeugung: Unbewusste Mechanismen
Der dritte vorläufige Ansatz: Unethisches, ethisches und überethisches Verhalten
Erste Beobachtung: Zuhause ist gut, aber Wandern ist gesegnet
Postrophische Analyse des Gedichts von I. A. Bunin
Das Phänomen des Wanderns in der Geschichte von L. N. Tolstoi „Vater Sergius“
Das Phänomen der Obdachlosigkeit im Evangelium
Die Voraussetzung „Das Haus ist gut“ vor dem Hintergrund des neutestamentlichen Wandergebots
Aussagen des Alten Testaments über den Wert eines Hauses
Blzhsni nzgnn die Wahrheit rddi
Zweite Beobachtung: „Zerstöre keine Berge, nur um deine Lehren zu verlassen.“
I. Kant und Johannes Chrysostomus über die Trennung von sanfter und strenger Ethik
Ein Beispiel für eine verzeihende Ethik
Die Fortsetzung des Geständnisses im alten gedruckten Potrebnik
Ethik der Untätigkeit (Enthaltung) in Ps
Beispiele strenger Ethik im Heiligen. Schrift
Beispiele strenger Ethik im slawisch-russischen Prolog
Eine kurze Geschichte von Prolog
Aus dem Leben des hl. Mary, die sich Marin anbot
Aus dem Leben des hl. Johannes, genannt Barsanuphios
Aus dem Leben des hl. Nikon vom Sinai, der angeblich Ehebruch mit der Tochter eines gewissen „Pharaoiten“ begangen hat
Ein Wort aus dem Patericon: Der Beleidigte entschuldigt sich beim Täter
Anhang 1 (zum Lager OZ-4). Infragestellung des Potrebnik als Spiegel der Moral in Russland in der Mitte des 17. Jahrhunderts
P. Rezeption von Platons Spekulationen über Ideen und ihre Eigenart
Rezeption des platonischen Ideenbegriffs
Noch einmal zur Darstellungsweise: Hinweis auf inneres Erfahrungswissen
gnoramus et ignorabimus oder ignoramus, sed non ignorabimus?
Platons Ideenlehre: eine Analyse zweier Interpretationen
Die Idee eines Pferdes
Platons Lehre ist eher beleidigend als gut
Das Gleichnis von den Gefangenen der Höhle
Vorstellungen von Haaren, Schmutz und Müll existieren nicht
Rezeption von Platons Lehre von der Eigenart der Ideen
Wissen heißt erinnern
Berechnung der Anteile einer Idee (unter Berücksichtigung ihrer Ursprünglichkeit)
Definition einer Idee durch Äquivalenz
Ontologische Attribute einer Idee
Idee – Konzept – „Ding“
Genetische Merkmale einer Idee
ntra te quaere Deum!
Statische und dynamische Ideen
Die Essenz des Sapientema-Phänomens
Sapientema „Wohnen ist (so) gut“: Spekulation über ein synergistisches Wesen
Drei anschauliche Beispiele
Obdachlose
Obdachloser Job
Obdachloser Wladimir Dubrowski
Sapientema – Kopulation von Ideen
Wasser, Brot, Gewand und Haus
Wohnen als Zufluchtsort vor dem Eindringen von außen
Naf-Yaf „baute ein Haus aus Steinen“
„.in den Eingängen ihrer eigenen Häuser getötet“
Steinfestung, Heimat der Zuflucht
Privatsphäre hinter verschlossenen Türen
Wohnen als Wetterschutz und Schlafplatz
Die Schrecken von Donner und Blitz
Holzverbindung im Haus, Fundament
„Schlaf – ochima, immer – dösen“
Sapientema ist ein Programm zur Entfaltung apriorischer Bedeutungen
Doli und RP Tactics Safe Haven Theme
Was empfand G.S. Skovoroda als Segen im Leben!
Die Referenzgruppe, in deren Namen der wandernde Philosoph sprach
Spekulatives, praktisches und „verbale“ Leben
Relativismus des Abstrakten und Konkreten
Doli und RPTactics zum Thema dauerhafte Zuflucht
Lingvosatentema – ein Programm zur Entfaltung a-posteriori-Bedeutungen
Doppel- und Flachdach
Aus verschiedenen Gründen hat das Haus eine Reihe von Nominierungen
Jeder hat eine Vorstellung davon, was ein typisches Hausdesign ist
Einem Gast, der ins Haus kommt, wird normalerweise eine Mahlzeit angeboten.
Wohnraum kann übernommen werden verschiedene Wege: bauen, kaufen, erben, als Mitgift erhalten, vom Staat erhalten, tauschen
Eigenheim hat einen hohen Stellenwert
Die Verfügbarkeit von Wohnraum ist eine Voraussetzung für das Wohlergehen der Familie
Das Haus benötigt ständige Wartungsanstrengungen; sonst bricht es zusammen
Das Haus ermöglicht vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: zum Wohnen mit der Familie, zur Kapitalanlage, zur Einkommensgenerierung
Die Rolle des Hausherrn genießt einen hohen Stellenwert
Die Rolle der Ehefrau, der Herrin des Hauses, wird hoch geschätzt
Ein wohlhabendes Zuhause sollte mit Wasser und Nahrungsmitteln versorgt werden.
Wohlhabendes Zuhause - wohlhabend
Kinder, Kinder, wo seid ihr Kinder?
Heimat – (nur) für „unsere“, nicht für „Fremde“
Metaphorische (expansive) Verwendung des Begriffs Heimat
Das Haus verfügt über Räumlichkeiten für physiologische Funktionen
Sapientema als dreifaches ethisches Bewertungsprogramm
Noch einmal über Ethik, Unethik und Superethik
Vorräte im Haus sind eine Lebensbedingung
Freiwilliger Tod als überethisches Verhalten
Doppelte ethische Bewertung
Wer ist mein Nachbar?
Gewissen als Naturgesetz
Dreifache ethische Bewertung
„Schönheit ist eine schreckliche, schreckliche Sache!“
Zehn Abschlussthesen zum Sapientema
Abschluss
Literatur
Nachwort (Yu. S. Stepanov)