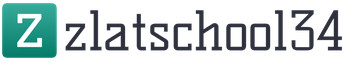1873 - 1941). Enkel des berühmten bulgarischen Revolutionärs Georgy Rakovsky. Geboren am 13. August 1873 in Kotel, Bulgarien. Im Alter von fünfzehn Jahren wurde er von der Schule verwiesen, weil er einen Studentenaufstand angeführt hatte, ohne das Recht zu haben, eine bulgarische Bildungseinrichtung zu besuchen. Mit siebzehn Jahren half er bei der Veröffentlichung von Engels‘ Werken. Um seine Ausbildung fortzusetzen, reiste er 1891 in die Schweiz, wo er unter politischen Emigranten ein aktives Mitglied des internationalen Kreises sozialistischer Studenten wurde und gleichzeitig seine Artikel in der bulgarischen Zeitschrift Sotsial-Demokrat veröffentlichte. Er studierte am Medizinischen Institut in Genf, traf die russischen Revolutionäre Axelrod, Plechanow und Sasulich und lernte Rosa Luxemburg näher kennen. 1893 organisierte er den Zweiten Internationalen Kongress sozialistischer Studenten. Im selben Jahr vertrat er Bulgarien auf dem Internationalen Sozialistenkongress in Zürich und war dessen Delegierter auf dem Internationalen Sozialistenkongress in London im Jahr 1896. Im Jahr 1897 schloss er sein Studium an der medizinischen Fakultät in Montpellier ab und verfasste seine Dissertation „Ursachen von Verbrechen und Degeneration“. ein großer Erfolg in Wissenschaftlerkreisen und wurde mehr als einmal in Fachschriften zitiert. Aber die medizinische Praxis des Genossen Rakowski war nicht attraktiv, und er war nur ein halbes Jahr damit beschäftigt, und während des Militärdienstes sogar in der rumänischen Armee. Im Jahr 1899 besuchte Genosse Rakowski zum ersten Mal St. Petersburg, wo er bei einem der Streitigkeiten eine Rede hielt, woraufhin er vor der Verhaftung fliehen musste. Im Jahr 1900 kam er erneut nach St. Petersburg, wurde jedoch zwei Wochen später ausgewiesen und reiste nach Frankreich, um am internationalen Sozialistenkongress in Paris teilzunehmen. In Frankreich besuchte er einen Universitätskurs in Rechtswissenschaften und pflegte gleichzeitig Kontakt zu den bulgarischen Sozialdemokraten. und Beziehungen zum Serben knüpfen. Er vertrat die bulgarische und die serbische Partei auf dem Amsterdamer Kongress der Zweiten Internationale im Jahr 1904. Im Jahr 1905 reiste Genosse Rakowski nach Rumänien, wo er das Organ der Rumänischen Sozialistischen Partei Arbeiterrumänien gründete. Leitete eine Kampagne zum Schutz der Potemkinschen Seeleute, als diese 1905 nach Rumänien flohen. 1907 verwies ihn die rumänische Regierung als sozialistischen Agitator und Täter der Bauernaufstände, die das Land erfassten. Angesichts der anhaltenden Forderungen der Arbeiter- und Bauernmassen des Landes wurde Genosse Rakowski fünf Jahre später (1912) die Einreise nach Rumänien gestattet. Während seines Exils vertrat Genosse Rakowski die Rumänische Partei auf zwei internationalen Kongressen in Stuttgart und Kopenhagen sowie auf einer Konferenz der sozialistischen Parteien des Balkans im Jahr 1911 in Belgrad. Am Vorabend des ersten Balkankrieges organisierte er in Konstantinopel eine Konferenz der sozialistischen Parteien des Balkans, um einen Aktionsplan gegen die militärische Gefahr zu entwickeln. Teilnahme an der Zimmerwald-Konferenz von 1915. Von August 1914 bis August 1916 war Genosse Rakowski zusammen mit dem rumänischen Sozialdemokraten. Ich musste einen großen Kampf ertragen und die Neutralität des Landes gegen zwei Militärparteien verteidigen – die Russophilen und die Germanophilen. Und sobald Rumänien in den Krieg eintrat, wurde Genosse Rakowski von der rumänischen Regierung ins Gefängnis geworfen, die ihn auf dem Rückzug von Bukarest nach Iasi mitschleppte. Am 1. Mai 1917 wurde Rakowski von der russischen Garnison in Iasi befreit. Kam im Mai 1917 in Russland an und trat im November der Bolschewistischen Partei bei. Nach der Oktoberrevolution leitete er die politische Verwaltung des Revolutionären Militärrats der Republik. Als Abgesandter der Regierung der RSFSR wurde er in den Süden Russlands, nach Sewastopol und Odessa, entsandt. Nach der Besetzung der Ukraine durch die Zentralrada wurde Genosse Rakowski an die Spitze der sowjetischen Delegation für Verhandlungen mit der Ukrainischen Volksrepublik und dann mit der Regierung Skoropadskis gestellt. Tov. Rakowski schloss gleichzeitig einen Waffenstillstand mit den Deutschen und wurde dann im September 1918 an die Spitze einer Notfallmission nach Deutschland geschickt, um die Verhandlungen mit der deutschen Regierung über einen Friedensvertrag mit der Ukraine fortzusetzen. Von Berlin aus hat er zusammen mit t.t. Joffe und Bucharin wurden unterwegs von den deutschen Behörden vertrieben und verhaftet, aber die deutsche Revolution befreite ihn. In den Jahren 1918-1923. - Vorsitzender des Rates der Volkskommissare der Ukraine. Seit 1923 - Bevollmächtigter in Großbritannien, 1925-1927. - in Frankreich. 1919-1927. - Mitglied des Zentralkomitees der Partei. Mitglied des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees. Zentrales Exekutivkomitee der UdSSR. Aus den wichtigsten literarischen Werken Rakowskis, die in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden, heben wir hervor: „Die Ursachen von Verbrechen und Degeneration“, „Russland im Osten“, „Essays über das moderne Frankreich“, „Metternich und sein Leben“. Zeit“, „Unser Unterschied“, „Russisch-Japanischer Krieg“, „Sozialisten und Krieg“. Seine zahlreichen Artikel über internationale Politik, wissenschaftlichen Sozialismus und Geschichte wurden in verschiedenen Zeitschriften (bulgarisch, französisch, russisch, polnisch, deutsch, rumänisch usw.) veröffentlicht. Unterdrückt; Nach sechs Jahren im Exil und einem erfolglosen Fluchtversuch, gebrochen im Geiste und in schlechter Gesundheit, ging er 1934 zur Zusammenarbeit mit den Behörden. Im Dezember 1936 wurde er erneut verhaftet und unterdrückt; im Februar 1988 wurde er posthum rehabilitiert.
Tolle Definition
Unvollständige Definition ↓
Rakowski, Christian Georgievich
Rakowski X. G.
(1873-1941; Autobiographie). - Ich wurde am 13. August 1873 in der bulgarischen Stadt Kotel geboren. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Kotel zu einem wichtigen wirtschaftlichen und politischen Zentrum. Die Familie, in der ich geboren wurde, gehörte zur reichsten Klasse der Stadt. Mein Vater war in der Landwirtschaft und im Handel tätig. Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Umstand verbrachte er jedes Jahr mehrere Monate in Konstantinopel. Er gehörte der sogenannten „Demokratischen Partei“ an, zeichnete sich durch Neugier aus, erhielt eine gymnasiale Ausbildung und beherrschte die griechische Sprache. Allerdings habe ich seitens meines Vaters nichts geerbt, was meine weitere Entwicklung hätte bestimmen sollen.
Eine andere Sache ist die Vererbung durch die Mutter. Sie gehörte einer Familie an, die eine wichtige Rolle in der politischen und kulturellen Geschichte des bulgarischen Volkes spielte. Aus dieser Familie stammte Hauptmann Georgy Mamarchev, ein ehemaliger Offizier der russischen Armee von Dibich-Sabalkansky, der 1834 den ersten Versuch eines organisierten Aufstands gegen die türkische Herrschaft unternahm. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, Mamatschow selbst wurde zunächst verhaftet und verbannt Kleinasien und dann auf die Insel Samos, wo er starb. Er war der Bruder der Mutter des berühmten Revolutionärs Savva Rakovsky, dessen Persönlichkeit die gesamte politische und politische Welt dominierte Kulturelle Geschichte Bulgarien von 1840 bis 1867 Savva Rakovsky, der sich in Rumänien aufhielt, organisierte dort 1841 eine aufständische Abteilung, um in Bulgarien einzumarschieren. Er wurde verhaftet und zum Tode verurteilt, floh aber nach Frankreich. Die Amnestie gab ihm die Möglichkeit, in seine Heimatstadt zurückzukehren, allerdings nicht für lange. Bald wurden Vater und Sohn in das Gefängnis von Konstantinopel gebracht. Die Rachsucht ihrer politischen Gegner übertrug sich auch auf die verbliebene wehrlose Familie, übrigens auf meine Mutter, damals noch ein Mädchen. Die Familie wurde aus der Kirche „exkommuniziert“ und den Nachbarn war jeglicher Zutritt zur Kirche verboten, sodass sie in der Zeit, in der keine Streichhölzer vorhanden waren, als sie den Kamin anzündeten und Feuer von den Nachbarn nahmen, mit Kälte und Hunger bezahlen musste für die politischen Sünden ihres Vaters und ihrer Brüder. Obwohl ich mein bewusstes Leben viele Jahre nach dem Tod von Savva Rakovsky begann, waren die Erinnerungen an meine Mutter und Großmutter immer noch frisch genug, um meiner Fantasie freien Lauf zu lassen.
Von früher Kindheit an entwickelte ich eine starke und leidenschaftliche Sympathie für Russland – nicht nur, weil die revolutionären Aktivitäten meiner Großväter und Onkel größtenteils mit Russland verbunden waren, sondern auch, weil ich Zeuge war Russisch-türkischer Krieg. Ich war damals gerade mal fünf Jahre alt, aber in meiner Kindheitserinnerung blieb ein vages Bild von russischen Soldaten, die damals durch den Balkan zogen. Unser Haus war eines der besten der Stadt und wurde daher zur Wohnung der höheren Offiziere. Ich traf auch General Totleben, den Organisator der Belagerung von Plewna; Ich traf Prinz Vyazemsky, einen der Chefs der Division der bulgarischen Miliz, und verabschiedete ihn, der verwundet mehr als vierzig Tage in unserem Haus lag. Unter den Beamten befanden sich auch Personen, die mit Untergrundorganisationen in Verbindung standen, über die sich in meiner Familie die Legende erhalten hat, dass sie sagten: „Wir befreien dich, aber wer wird uns befreien?“ Der Krieg brachte eine Erschütterung in das Leben meiner Familie: Unser Anwesen befand sich innerhalb der Grenzen des rumänischen Staates und die ganze Familie musste in die rumänische Dobrudscha auswandern.
Ich habe meine Grundschulausbildung in den Bergen erhalten. Kotel und setzte es dann in der Dobrudscha unter der Anleitung seiner Mutter fort. Letztes Jahr Grundschule Ich habe in Varna verbracht. Hier betrat ich die Turnhalle. Es war zu einer Zeit, als sich bereits die jüngsten Studenten für Politik interessierten. Unter anderem begann ich, mich für das öffentliche Interesse zu engagieren. Im Jahr 1887 kam es aufgrund der politischen Unruhen unter den Schülern, die sich mit Elementen persönlicher Unzufriedenheit mit einigen Lehrern vermischten, zu einem Uniformaufstand, der durch den Einsatz einer Soldatenkompanie befriedet werden musste. Ich gehörte zu den Verhafteten und auch zu denen, die aus allen bulgarischen Schulen ausgeschlossen wurden. Ich verbrachte ein Jahr im Haus meines Vaters in Mangalia und las wahllos alles, was in der Bibliothek meines Vaters war oder von Bekannten gefunden werden konnte. 1888 durfte ich wieder das Gymnasium betreten und ging nach Gabrovo, wo ich in die 5. Klasse eintrat. Hier verbrachte ich weniger als zwei Jahre, denn vor dem Ende der 6. Klasse wurde ich erneut von allen bulgarischen Schulen verwiesen und dieses Mal – unwiderruflich.
In Gabrovo formalisierte ich meine politischen Ansichten und wurde Marxist. Mein Lehrer war einer der Veteranen der bulgarischen Revolutionsbewegung, Dabev. Zusammen mit meinem Kameraden Balabanov, der später auf tragische Weise in Genf starb, veröffentlichten wir die hektographierte Untergrundzeitung Zerkalo, die absolut alles enthielt: über die pädagogischen Ansichten von Rousseau, über den Kampf zwischen Arm und Reich und über das schlechte Benehmen von Lehrer usw. e. Wir haben unter den Bauern gearbeitet und die ins Bulgarische übersetzten Genfer Untergrundpublikationen verteilt. Als ich noch in der 5. Klasse war, ging ich zu Fuß in meine Heimatstadt Kotel und hielt in der Kirche eine Predigt über „die erste christliche Kirche St. Jakob“, also eine Rede über den christlichen Kommunismus. Aber im Allgemeinen gingen unsere Aktivitäten nicht über die Mauern der Turnhalle hinaus. Im Herbst 1890 ging ich nach Genf, um an der medizinischen Fakultät zu studieren. Ich habe mich für die Medizin entschieden, weil sie aus unserer Sicht die Möglichkeit bietet, in direkten Kontakt mit den Menschen zu treten. Damals kannten wir nur individuelle Einflussnahme, an Massenarbeit dachten wir noch nicht. Uns kam es so vor, als würde das Regime des bulgarischen Diktators Stambulow ewig bestehen.
Als ich mich in Genf befand, lernte ich in den nächsten Monaten die russische politische Emigration und insbesondere die russischen sozialdemokratischen Kreise kennen. Einige Zeit später lernte ich Plechanow, Sassulitsch und Axelrod kennen, und ihr Einfluss auf mich war viele Jahre lang entscheidend.
Ich war drei Jahre lang, von 1890 bis 1893, in Genf. Obwohl ich Student war und sogar Prüfungen ablegte, war mir die Medizin völlig gleichgültig. Meine Interessen lagen außerhalb der Mauern der Universität. Ich habe mich schnell in die Arbeit unter den russischen Studenten eingearbeitet. Zusammen mit Rosa Luxemburg, die einige Zeit in Genf lebte, leiteten wir marxistische Zirkel zur Selbstbildung.
Meine Tätigkeit beschränkte sich jedoch nicht auf russische Interessen. Zusammen mit anderen Genossen, Ausländern und Russen, organisierten wir die sozialistischen Elemente der Genfer Studenten. Wir kontaktierten sozialistische Studenten aus anderen Ländern, insbesondere aus Belgien, wo im Winter 1891-1892. Der erste internationale Kongress sozialistischer Studenten fand statt. Es gelang mir nicht, an diesem Kongress teilzunehmen, obwohl ich mit den Organisatoren in Korrespondenz stand. Andererseits wurden mir tatsächlich alle Vorbereitungsarbeiten für die Organisation des zweiten Kongresses, der in Genf stattfand, anvertraut. In allen schwierigen Fällen meiner Arbeit habe ich Plechanow konsultiert. Ich nahm auch Kontakt zur Genfer Arbeiterbewegung und zur französischen Arbeiterpartei auf. In Genf stand ich auch den polnischen und armenischen sozialistischen Revolutionskreisen nahe, aber meine Hauptarbeit war bulgarischer Natur. Ich habe Devilles Buch „Die Evolution des Kapitals“ übersetzt, begleitet von einer langen Einleitung mit einer Analyse der Wirtschaftsbeziehungen in Bulgarien. Später gaben wir von Genf aus eine Zeitschrift in Bulgarien heraus, die nicht nur im Namen, sondern auch im Format und im äußeren Umschlag eine Nachahmung der russischen Auslandszeitschrift „Social Democrat“ war. Aber das war verständlich, da Plechanow auch der Inspirator unserer Zeitschrift war. Ich habe eine Reihe von Artikeln direkt aus seinem Manuskript übersetzt. Als in Bulgarien die erste marxistische Zeitschrift „Den“ entstand und die erste Wochenzeitschrift „Sozialdemokrat“ gegründet wurde. Zeitung „Worker“ und „Drugar“ („Genosse“), ich wurde natürlich ihr ständiger Mitarbeiter, insbesondere letzterer. Manchmal war die ganze Länge mit meinen Artikeln unter verschiedenen Pseudonymen gefüllt. Im Jahr 1893 nahm ich als Delegierter aus Bulgarien am Sozialistischen Internationalen Kongress in Zürich teil. Die Genfer Periode endete für mich mit der Stärkung meiner marxistischen Ansichten und der Intensivierung meines Hasses auf den russischen Zarismus.
Noch während meines Studiums in Genf reiste ich nach Bulgarien, wo ich eine Reihe von Berichten las, die sich gegen die zaristische Regierung richteten. Im Jahr 1897, als ich mein Universitätsstudium abschloss, veröffentlichte ich in Bulgarien ein großes Buch mit dem Titel „Russland dem Istok“, das jahrelang nicht nur der Bulgarischen Sozialistischen Partei gegen den russischen Zarismus Nahrung lieferte, sondern allen sogenannten. Russophobe Strömungen in Bulgarien und auf dem Balkan. Ich folgte Plechanows Anweisung: „Das zaristische Russland muss international isoliert werden.“ Aber schon bei meinen ersten Reisen nach Bulgarien hatte die bulgarische bürgerliche Presse auf mich aufmerksam gemacht. Schon als Student führte die russophile Presse eine Kampagne gegen mich. Im Herbst 1893 trat ich in die medizinische Fakultät in Berlin ein mit dem Ziel, die deutsche Arbeiterbewegung näher kennenzulernen. In Berlin begann ich mit Vorverts in Balkanangelegenheiten zusammenzuarbeiten. Ich habe auch am Deutschkurs teilgenommen sozialistische Organisationen, das Untergrundcharakter hatte, und ging eine enge Beziehung zu Wilhelm Liebknecht ein. Bei Liebknecht traf ich auch andere Führer der deutschen Sozialdemokratie. Parteien. Liebkiecht hatte einen großen Einfluss auf mich. Mit ihm pflegte ich bis 1900 persönlichen Kontakt und Briefwechsel. Er zeigte ein sehr großes Interesse am Balkan, interessierte sich sehr für die russische, polnische und rumänische Revolutionsbewegung. In Berlin, alle meine Schüler politisches Leben in der russischen Kolonie stationiert. Dies war die Blütezeit des russischen Rechtsmarxismus. Die russische Kolonie in Berlin lebte von Streitigkeiten: über Populismus und Marxismus, über die subjektivistische Schule, über den dialektischen Materialismus. Ich musste aber auch an konkreteren Auseinandersetzungen teilnehmen (zum Beispiel gegen die Zionisten).
Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Berlin wurde ich verhaftet und wenige Tage später abgeschoben. Das Sommersemester 1804 verbrachte ich an der Medizinischen Fakultät in Zürich, wo damals auch P. B. Axelrod wohnte. Winter 1894-1895
Ich habe in Nancy verbracht. Ich setzte meine Verbindung mit der bulgarischen Bewegung sowie meinen persönlichen Briefwechsel mit Plechanow an W. I. Zasulich fort, der damals in London lebte.
Die letzten zwei Jahre meines Studentenlebens habe ich in Montpellier (Frankreich) verbracht. Indem ich meine Verbindung zu Bulgarien und meine Arbeit unter russischen und bulgarischen Studenten fortsetzte, begann ich gleichzeitig, mich der französischen sozialistischen Bewegung zu nähern und an der marxistischen Zeitschrift „Socialist Youth“ mitzuarbeiten, die ebenfalls in Toulouse unter der Herausgeberschaft von Lagardel erschien wie in der sozialistischen Tageszeitung „La Petite République“, als sie unter der Leitung von Jules Guesde stand. Der Streit unter den russischen Studenten in Montpellier drehte sich um dieselben Fragen wie in Berlin. Die Zionisten hatten hier übrigens mehr Anhänger. Ich habe hart gegen sie gekämpft. Ich nahm auch an einem französischen Studentenkreis teil und sprach bei geschlossenen Arbeitstreffen. Bereits in Nancy stand ich unter der Aufsicht der französischen Polizei und angesichts dieser Tatsache konnte ich meine Aktivitäten natürlich nicht ausweiten.
Das Ende meines Studentenlebens fiel mit internationalen Ereignissen zusammen, die die politische Atmosphäre in Europa wiederbelebten: dem Aufstand in Armenien und auf der Insel Kreta. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen habe ich in einer Reihe von Artikeln versucht, die Aufmerksamkeit der Sozialistischen Partei Frankreichs und des französischen Proletariats auf die Zweckmäßigkeit der Fürbitte für die Armenier, Kreter und Mazedonier zu lenken. Im Allgemeinen war ich der Ansicht, dass Unwissenheit und Missverständnisse gegenüber östlichen Fragen eine der Schwächen der internationalen sozialistischen Bewegung waren. Diese Frage war übrigens Gegenstand eines Berichts, den ich im Namen der bulgarischen Sozialdemokraten vorgelegt habe. Partei auf dem Londoner Internationalen Sozialistischen Kongress im Jahr 1896. Es wurde später von Kautsky in der Neuen Zeit veröffentlicht.
Meine medizinische Ausbildung habe ich mit einer Doktorarbeit zum Thema „Die Ursachen von Kriminalität und Degeneration“ abgeschlossen. Ich wollte mich dieser Frage aus marxistischer Sicht nähern. Diese Dissertation erregte großes Aufsehen bei Studenten und Professoren und fand ihren Niederschlag in der lokalen Presse und anschließend in der Fachweltliteratur.
In Montpellier begann ich mich auch mehr für die rumänische Arbeiterbewegung zu interessieren. Obwohl ich aufgrund meiner Nationalität als Rumäne galt, bin ich erst spät eine formelle Beziehung zu den rumänischen Kameraden eingegangen. In London kam ich auf dem internationalen Sozialistenkongress den Polen der PPS nahe. Ich beteiligte mich an ihren französischen Veröffentlichungen, die sich gegen den russischen Zarismus richteten. Von den anderen revolutionären Parteien interessierte ich mich besonders für die hintschakistischen Armenier, mit deren Sekretär ich seit Genf in persönlichem Kontakt stand.
Im Jahr 1893 hatte ich in Zürich das Glück, Engels zu sehen und zu hören. Als ich in Genf war, standen Engels und ich in gelegentlichem Briefwechsel. Er schickte einen Brief an unseren bulgarischen Sozialdemokraten. Als es später notwendig wurde, ihn zu kontaktieren, tat ich dies über V. I. Zasulich, den er mit tiefer Liebe und Respekt behandelte.
Als ich 1896 mein Studium an der Universität abschloss, stellte sich für mich die Frage: Wohin sollte ich als nächstes gehen? Meine Arbeit ging weiter, Kap. arr., in der Bulgarischen Sozialistischen Partei. Andererseits war ich rumänischer Nationalität. Schließlich war mein sehnlicher Wunsch – verstärkt durch die Tatsache, dass ich eine Russin aus Moskau, eine enge Freundin von Plechanow und Sassulitsch, eine marxistische Revolutionärin E. P. Ryabova – geheiratet hatte, in Russland zu arbeiten, um dort zu arbeiten.
Ich habe Bulgarien besucht und alle Zentren bereist, über die ich Berichte gelesen habe andere Themen, und nachdem ich die ärztliche Untersuchung bestanden hatte, um für alle Fälle das Recht zu haben, in Bulgarien als Arzt zu praktizieren, beschloss ich, als Etappe auf dem Weg nach Russland vorübergehend in Rumänien anzuhalten. Außerdem musste ich meinen Wehrdienst ableisten, nachdem ich auch die ärztlichen Voruntersuchungen in Bukarest bestanden hatte. Ich habe meinen Militärdienst als Militärarzt abgeleistet. Im Februar 1899 erhielt ich einen zweiwöchigen Urlaub und fuhr nach St. Petersburg, wo meine Frau bereits dort war. In Russland war es der legalen marxistischen Literatur zu dieser Zeit bereits gelungen, eine eigene Zeitschrift zu haben, Nashe Slovo und dann Nachalo. Im ersten dieser Magazine veröffentlichte ich unter dem Pseudonym Radev einen Artikel über die politischen Parteien in Bulgarien. Zu dieser Zeit gab es in Petersburg eine hitzige Debatte zwischen den Volkstümlern und den Marxisten. Ich nutzte meinen Aufenthalt dort, um in einer Zweigstelle der Free Economic Society über dasselbe Thema zu sprechen. Da ich meinen Nachnamen nicht verheimlichte, war es für die russische Polizei nicht schwer, an mich heranzukommen. Aber als sie meine Adresse herausfand, war ich nicht mehr in Petersburg.
Der Militärdienst beeinträchtigte meine literarische Arbeit nicht.
Ich schrieb weiterhin fleißig Beiträge für bulgarische sozialistische Zeitschriften. Anstelle von Den hieß das Organ der Partei nun Novoe Vremya, das monatlich unter der Leitung von Blagoev erschien. Darüber hinaus veröffentlichte ich auf Bulgarisch ein Buch „Über die politische Bedeutung der Dreyfus-Affäre“ sowie eine polemische Broschüre gegen Spiritualisten mit dem Titel „Wissenschaft und Wunder“. Ich habe auch meine Doktorarbeit für eine populäre Veröffentlichung in Russland überarbeitet und es geschafft, sie unter dem neuen Titel „Unglücklich“, unterzeichnet von der Ärztin Stanchova, durch die zaristische Zensur zu bringen. Es wurde auch auf Bulgarisch veröffentlicht, allerdings unter dem Namen seines eigentlichen Autors. Gleichzeitig bereitete ich ein Buch über „Das moderne Frankreich“ vor, das mir der St. Petersburger Verlag „Knowledge“ bestellt hatte. Während meines kurzen Aufenthalts in Petersburg erwartete ich ein Treffen mit Lenin, der sich zu dieser Zeit in Pskow aufhielt. Aber es ist mir nicht gelungen. Mein Militärdienst in Rumänien endete am 1. Januar 1900. Nachdem ich meine Offiziersuniform ausgezogen hatte, konnte ich in der rumänischen sozialistischen Presse und auf einer Arbeiterversammlung in Bukarest offen sprechen. Aber ich tat dies nur, um die völlige Liquidierung der rumänischen Arbeiterbewegung infolge des Verrats ihrer Führer festzustellen, die fast vollständig zur liberalen Partei Bratiana übergingen. Da ich aber nach Russland strebte, war meine damalige Tätigkeit der rumänische Arbeiter. Die Bewegung beschränkte sich auf diese Aufführung. Durch meine Hände in Rumänien ging ein umfangreicher Briefwechsel zwischen Sassulitsch und Plechanow einerseits und den Petersburger Marxisten andererseits; Ich habe es meiner Frau nach Petersburg geschickt. Vor meiner Abreise nach Russland kam Zasulich selbst nach Rumänien, von wo aus ich sie, nachdem ich ihr einen rumänischen Pass auf den Namen Kirova ausgestellt hatte, nach Russland schickte, wohin ich in einigen Monaten folgen würde. Zu dieser Zeit tobte bereits ein Kampf zwischen den Bernsteinianern, also Struve, und den revolutionären Marxisten. Plechanow war besonders empört über den Abtrünnigen seines engen Kameraden. Er schrieb mir in Rumänien, dass es notwendig sei, auch mit Michailowski einen Block gegen Struve zu schließen, und schlug vor, dass ich ihm bei meiner Ankunft in Petersburg unter dem Namen Beltow bei der Zusammenarbeit in Russkoje Bogatstvo helfen sollte.
In Petersburg habe ich folgendes Bild gefunden: eine scharfe Rechtskurve von Struve.
Er machte V. I. Zasulich bittere Vorwürfe für die Rückkehr nach Russland, da sie bei einem Scheitern ihre „Freunde“ kompromittieren könnte. Dies verärgerte Zasulich zutiefst, der Struva seit London (1896), wo er nach dem internationalen Sozialdemokraten blieb, stark verbunden war. Tagung für ein paar Wochen. Es stellte sich heraus, dass Mikhailovsky, Karpov Annensky und ganz zu schweigen von unseren Marxisten (Tugan-Baranovsky, Veresaev, Bogucharsky usw.) sich in der Wohnung meiner Frau mit V. I. Zasulich trafen, Struve sie jedoch lange Zeit nicht sehen wollte.
Was Plechanows Plan zur Zusammenarbeit in „Russkoje Bogatstvo“ betrifft, so hielten wir ihn, nachdem wir ihn in russischen Kreisen besprochen hatten, für ungeeignet. Wir hielten es für sinnvoller, dass Plechanow an der von Posse und Gorki herausgegebenen Zeitschrift „Life“ mitarbeitete.
Ich persönlich war mit meiner Ankunft in Petersburg äußerst zufrieden. Ich atmete tief die Winterluft ein und träumte von einem längeren Job in Russland. Gemeinsam mit meiner Frau und Kameraden (darunter A. N. Kalmykova, N. A. Struve, die links von ihrem Mann stand) erstellten wir Pläne für die Arbeit unter der Jugend und unter den Arbeitern; Ich habe mein Buch Modern France geschrieben. Doch sehr bald nach meiner Ankunft wurde mir mitgeteilt, dass ich Russland innerhalb von 48 Stunden verlassen müsse. Diese Vertreibung hat alle meine Pläne zunichte gemacht. Ich hatte keine Lust, auf den Balkan zurückzukehren. Je näher ich der revolutionären Bewegung in Russland kam, desto weniger interessierte ich mich für sie. Ich wurde gebeten, unter Polizeiaufsicht nach Reval zu fahren und auf die Abfahrt des Dampfers zu warten. Ich war mit meiner Frau dort. Dort beendete ich „Modern France“, veröffentlicht unter einem Pseudonym. Insarov (ausgewählt von meinen Petersburger Freunden).
Zu den anderen, die sich aktiv an den Bemühungen beteiligten, mich in St. Petersburg zurückzulassen, gehörte N. I. Gurovich, der sich später als Provokateur herausstellte. Bevor er ging, versicherte er mir, dass er dank seiner Verbindungen am Hof (entweder zu seinem Bruder oder zum Schwiegersohn von Baron Frederiks) sicher sei, dass er mich nach einer Weile nach Russland zurückbringen könne. Dasselbe wiederholte er in Paris, wohin er im Sommer 1900 kam. Gurovichs Zusicherungen über die Möglichkeit einer Rückkehr wurden immer häufiger. Schließlich ging es darum, Geld zu geben, „um die Verwandten von Baron Fredericks zu bestechen“. Dies war natürlich nicht der Fall und ich kehrte wieder nach Russland zurück. Vor meiner Abreise nach Russland habe ich mich als Student an der juristischen Fakultät in Paris eingeschrieben. Ich dachte, dass ich nach dem, was ich in St. Petersburg erlebt hatte, nicht lange in Russland bleiben könnte und wieder nach Frankreich gehen müsste.
In Petersburg habe ich die Wüste gefunden. Nach Studentenunruhen im Frühjahr 1901 wurden viele Schriftsteller von dort vertrieben, darunter viele legale Marxisten. Die einzige Verbindung, die mir blieb, war die zur Untergrundwelt, wo Lenins Broschüre „Chto Delat“ bald zur Tagesordnung wurde.
Zu dieser Zeit gehört meine verstärkte Mitarbeit an russischen „dicken“ Zeitschriften, die bis einschließlich 1904 andauerte, Kap. arr. unter Pseudonym. Insarov und Grigoriev, aber all dies konnte meinen Durst nach lebhafter Aktivität nicht stillen, und nach dem Unglück, das mir widerfuhr – dem Verlust meiner Frau – kehrte ich Ende 1902 nach Frankreich zurück und begann, Prüfungen an der juristischen Fakultät abzulegen die Absicht, sich dort niederzulassen und als französischer Staatsbürger aktiv an der Revolution teilzunehmen. Bewegung.
Aus dieser Zeit stammt meine einzige freie Arztpraxis, die nicht länger als sechs Monate im französischen Dorf Beaulieu im Département Loire dauerte. Ich knüpfte nicht nur berufliche, sondern auch politische Beziehungen zu den Bauern, insbesondere nach meiner Rede bei einem offiziellen Bankett, bei der ich eine Rede hielt, die bei den anwesenden Senatoren und Abgeordneten auf großes Missfallen stieß. Ich wurde gebeten, in Beaulieu zu bleiben. Der Tod meines Vaters im Sommer 1903 zwang mich zur Rückkehr nach Hause. Von diesem Moment an komme ich wieder auf die Balkanparteien zurück, insbesondere auf die rumänische Arbeiterbewegung.
Im Winter 1903/04. Ich kehrte nach Paris zurück. Der Russisch-Japanische Krieg fand mich in Paris. Bei einem großen Treffen, bei dem Vertreter aller revolutionären Parteien anwesend waren, habe ich auch gesprochen. Meine Rede mit ihrem defätistischen Geist provozierte die Vorwürfe meines Lehrers Plechanow, der der Vorsitzende der Versammlung war. Er war vor der Kriegserklärung nach Paris gekommen, um die Zeitung zu lesen, und da er aus Frankreich ausgewiesen worden war, musste die Unterstützung von Clemenceau in Anspruch genommen werden, um ihm eine vorübergehende Einreise zu ermöglichen. Ich erinnere mich, wie Plechanow am Tag nach diesem Treffen, als er mit mir bei Jules Guesde speiste, sich bei diesem über meine defätistische Stimmung beklagte. Ich erinnere mich, wie Jules Guesde sentimental antwortete: „ Sozialdemokratie kann niemals antinational sein.“ Viele Male später erinnerte mich Plechanow an diesen Satz von Ged. Nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Paris kehrte ich nach Rumänien zurück und ging von dort nach Bulgarien, wo die Spaltung zwischen den „engen“ und „ „breit“ war bereits eine abgeschlossene Tatsache. Ich wurde aktiv und entschlossen auf der Seite der „Knie“.
Im selben Jahr reiste ich als bulgarischer Delegierter zum Internationalen Sozialistischen Kongress nach Amsterdam. Gleichzeitig erhielt ich auch ein Mandat vom serbischen Sozialdemokraten. Parteien. In Amsterdam beteiligte ich mich aktiv an der Arbeit der Taktikkommission. Hier in Amsterdam sprach ich im Namen der russischen Delegation auf einer Arbeiterversammlung, deren Thema die Ermordung von Plehve war.
Ich kehrte nach Rumänien zurück. Die Ereignisse vom 9. Januar 1905 waren ein Weckruf für die rumänische Arbeiterklasse. Wir gründeten die Wochenzeitung „Arbeiterrumänien“ und initiierten damit eine arbeiterpolitische Organisation unter demselben Namen. Anders als der liquidierte rumänische Sozialdemokrat. Als Partei richteten wir unser Hauptaugenmerk auf die Organisation der Gewerkschaften, um die Sozialdemokraten zu unterwerfen. Partei rein proletarischer Basis. Die frühere Bewegung in Rumänien zeichnete sich gerade dadurch aus, dass sie keinen proletarischen Charakter hatte. Sie bestand aus Intellektuellen, dem Kleinbürgertum und einer relativ kleinen Zahl von Arbeitern. Der Zeitraum erwies sich als äußerst günstig. Die rumänische Arbeiterklasse reagierte bereitwillig auf den Aufruf des „Arbeiterrumäniens“. Die Streikbewegung hat ein solches Ausmaß erreicht, dass sogar die städtischen Städte Bukarests sich mit der Bitte an uns wandten, ihren Streik zu organisieren. Immer mehr Gewerkschaften wurden gegründet. Sowohl die Kapitalisten als auch die Regierung wurden überrascht und die ersten Streiks endeten schnell und erfolgreich. Doch die Gastgeber gaben nur nach, um sich besser auf die Offensive vorzubereiten.
Die Jahre 1905 und 1906 vergingen in Rumänien im Zeichen eines heftigen Klassenkampfes. Die rumänische Presse aller Couleur sah in mir den Initiator dieser ganzen Bewegung und glaubte, sie könne so die gesamte Arbeiterbewegung Rumäniens kompromittieren, indem sie ihre Kampagne gegen mich, einen gebürtigen Ausländer, konzentrierte. Zwei Ereignisse erzürnten die rumänische Regierung und die rumänischen herrschenden Klassen zusätzlich gegen mich: die Ankunft des Schlachtschiffs Potemkin in Constanta und der Bauernaufstand im Frühjahr 1907. Im Erscheinen der Potemkin in Constanta und in meiner Beteiligung an der Anordnung der Matrosen, die mit ihrer Hilfe eine Revolution in Rumänien auslösten und damit die russische Revolution unterstützten. Wir haben uns jedoch ein bescheideneres Ziel gesetzt – die politische Bildung der Potemkiniten. Zwischen der Ankunft der „Potemkin“ und dem rumänischen Bauernaufstand von 1907 ereignete sich eine weitere Tatsache, die die rumänische Regierung noch mehr alarmierte. Beladen mit Waffen aus Varna (wie ich später erfuhr – von Litvinov) wurde der für Batum bestimmte Dampfer an die rumänische Küste geworfen und von den rumänischen Behörden gekapert. Ich hatte ein Treffen mit dem Team, zu dem auch der Delegierte der Bolschewiki, Kamo, gehörte. Den Worten des letzteren entnahm ich, dass es sich hier um Verrat handelte, dass der Kapitän des Schiffes selbst das Ruder in Richtung Ufer drehte. Aber auf die eine oder andere Weise landete diese äußerst wertvolle Fracht, nicht weniger als 50.000 Gewehre, die offiziell für die mazedonische Revolutionsorganisation in der Türkei bestimmt war, in den Händen der rumänischen Regierung. Die rumänische Presse begann zu behaupten, dass diese Waffen dazu bestimmt seien, einen Aufstand in der Dobrudscha zu organisieren, und mein Name wurde in diesen Fall aufgenommen.
Im Februar 1907 brach in Rumänien ein Bauernaufstand aus, der sich zunächst gegen die jüdischen Pächter im Norden Moldawiens richtete und durch antisemitische Verfolgung rumänischer Liberaler und rumänischer antisemitischer Nationalisten ausgelöst wurde. Nachdem die Bauern jedoch die von jüdischen Pächtern bewohnten Ländereien zerstört hatten, gingen sie zu den Rumänen und dann zu den Grundbesitzern über. Die Lage Rumäniens wurde kritisch. Das ganze Land, also alle Dörfer, standen in den Flammen eines Bauernaufstandes. Die Bauern brannten die Ländereien nieder und ermordeten die Gutsbesitzer im Dorf. Die rumänische Regierung erschoss die Bauern und zerstörte die Dörfer mit Artillerie. Seine zweite Tat war ein schnelles Vorgehen gegen die Arbeiterbewegung, die am Vorabend der Bauernaufstände die Staatsmacht in den Städten in ständiger Angst hielt. Die Regierung hatte Angst vor der Vereinigung von Arbeitern und Bauern. Um die Arbeiterbewegung zu neutralisieren, wurden in den Städten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen: Durchsuchungen, Beschlagnahmung sozialistischer Zeitungen, Schließung von Räumlichkeiten von Gewerkschaften und Gewerkschaftsorganisationen, Verhaftung der Führer der Arbeiterbewegung. Ich war der Erste, der verhaftet wurde. Bald folgte meine scheinbar rechtswidrige Ausweisung aus Rumänien. Innerhalb von fünf Jahren wurde die Frage meiner Rückkehr zu einer praktischen Aufgabe, um die herum sich der Klassenkampf der rumänischen Arbeiter entfaltete. Während meines Exils beteiligte ich mich weiterhin an der Führung der rumänischen Arbeiterbewegung, leistete weiterhin Beiträge für die Zeitungen der Partei und der Gewerkschaftsbewegung, veröffentlichte Broschüren und auch sozialdemokratische. Zeitschrift „Soziale Zukunft“. Darüber hinaus habe ich zwei Bücher vorbereitet: eines auf Rumänisch – „Aus dem Reich der Willkür und Feigheit“, das andere auf Französisch – „Bojaren Rumänien“. Der erste war für die Arbeiter in Rumänien bestimmt, der zweite zur Information der sozialistischen Parteien und der öffentlichen Meinung im Ausland; Beide standen im Zusammenhang mit der Verfolgung der rumänischen Arbeiter und Bauern. Sie haben auch meinen Fall abgedeckt. Ich kehrte 1909 illegal nach Rumänien zurück, wurde verhaftet, aber wegen Gesetzesverstoßes wurde mir kein Prozess gemacht und ich wurde lediglich erneut deportiert. Hier kam es zu einem großen Skandal, da ich Widerstand leistete und sie mich mit Gewalt ins Auto stoßen mussten. Andererseits weigerten sich die ungarischen Behörden, mich aufzunehmen, und schickten mich wie ein Paket von einem Gebiet zum anderen, bis mich die ungarischen Behörden schließlich nach diplomatischen Verhandlungen zwischen der rumänischen und der österreichisch-ungarischen Regierung in ihrem Hoheitsgebiet aufnahmen. Meine Berechnungen und die meiner Genossen in unserer Organisation basierten alle auf den immer wiederkehrenden Prozessen rund um meinen Fall, die uns als Mittel zur Agitation unter den Arbeiterorganisationen dienten. Zuvor, bereits während meiner Abwesenheit aus Rumänien, im März und April 1908, ordnete die rumänische Regierung außerdem zwei Prozesse gegen mich an (um meine Ausweisung zu rechtfertigen, die eine illegale Handlung war, da es in Rumänien kein Gesetz dazu gab). auf deren Grundlage die Regierung ihre eigenen Bürger ausweisen konnte) griff auf die unglaublichsten juristischen Schikanen zurück und scheute sich nicht einmal, falsche Dokumente gegen mich zu fabrizieren. Wir haben versucht, in meiner Anwesenheit einen Prozess abzuhalten, aber die rumänische Regierung hat es vorgezogen, mich ins Ausland gehen zu lassen, anstatt mich im Gefängnis zu belassen und einen Prozess gegen mich einzuleiten, der in den Händen der Rumänischen Arbeiterpartei und in meinen Händen ein Mittel wäre des Kampfes gegen die Regierung und gegen die Bourgeoisie. Ich erzählte, wie mich 1909 die rumänische Polizei verhaftete und auf ungarisches Territorium warf. Obwohl die Tatsache der Festnahme verschwiegen wurde, gelangte sie dennoch an die Presse. Die rumänische Regierung begann, dies kategorisch zu leugnen. Die rumänische Arbeiterklasse, die aus Erfahrung wusste, dass die rumänische Regierung zu allen Arten von Gesetzlosigkeit fähig war, sah in dem Versuch der rumänischen Regierung, meine Verhaftung und meine Nichtaufnahme auf ungarischem Territorium zu verbergen, ein schlechtes Zeichen für die kriminellen Absichten der rumänischen Regierung mir gegenüber . Am Tag des 19. Oktober 1909 veranstalteten die Arbeiter in Bukarest, von Empörung erfasst, insbesondere nachdem in den Abendzeitungen eine Ankündigung über Bratianus Absicht erschien, „mich zu vernichten, anstatt mich nach Rumänien zurückkehren zu lassen“, eine Demonstration Straßen, die in einem blutigen Kampf mit der Polizei endeten. Neben Dutzenden Verletzten wurden etwa 30 Arbeiter festgenommen, darunter die Anführer der beruflichen und politischen Arbeiterbewegung, die noch in derselben Nacht in den Polizeikellern von Bukarest geschlagen wurden. Alle diese ungeheuerlichen Tatsachen lösten nicht nur in Rumänien selbst – in allen seinen großen und kleinen Arbeiterzentren und in der bürgerlich-demokratischen Presse –, sondern auch außerhalb Rumäniens Protest aus. Der Kampf zwischen den Arbeitern und der Regierung verschärfte sich. Es gibt einen erfolglosen Anschlag auf Bratiana, an dessen Organisation, wie sich herausstellte, die Polizei selbst beteiligt war. Das Attentat auf Bratiana war das Signal für eine neue Verfolgung der Arbeiter und für Ausnahmegesetze gegen das Streikrecht und die Rechte der Gewerkschaften. Bratianus Regierung konnte nicht länger an der Macht bleiben; Von den Arbeitern verflucht, verließ sie das Land und machte einer konservativen Regierung unter der Führung von Karp Platz. Im Februar 1911 kam ich erneut illegal nach Rumänien; Dieses Mal gelang es mir, in die Hauptstadt selbst zu gelangen, und nachdem ich meine Kameraden kontaktiert hatte, stellte ich mich den Justizbehörden. Und anstatt mir diesmal die Tore des Gefängnisses zu öffnen, zog es die rumänische Regierung vor, mich erneut auf fremdes Territorium zu werfen, und da die ungarischen Routen bereits gefährdet waren, versuchte die rumänische Regierung, mich nach Bulgarien zu schmuggeln.
Aber auch seine Versuche, mich über zwei Grenzpunkte auf bulgarisches Gebiet zu überführen, scheiterten. Der russische Weg, auf den die Regierung nicht zurückgreifen konnte, und schließlich der Seeweg standen meiner Ausweisung noch offen. Ich wurde auf einen Dampfer verladen, mit rumänischen Pässen versehen und nach Konstantinopel geschickt. Doch auch hier verhafteten mich die jungtürkischen Behörden einige Tage später auf Ersuchen der rumänischen Polizei. Das Eingreifen der türkischen sozialistischen Abgeordneten rettete mich aus dem türkischen Gefängnis. Ich kam nach Sofia und legte den täglichen Sozialisten ab. die Zeitung Wperjod, deren Hauptaufgabe darin bestand, den bulgarischen militanten Nationalismus zu bekämpfen, der einen Balkankrieg vorbereitete. Natürlich wurde ich zum Ziel von Angriffen aller bulgarischen Nationalisten.
Unterdessen bereitete sich in Rumänien ein Wendepunkt zu meinen Gunsten vor. Der Hauptfeind unserer Arbeiterbewegung war die liberale Partei, die nicht nur die Grundbesitzer und das Pächterkapital vertrat, sondern auch Ch. arr. und Industriekapital. Nach einigen Zugeständnissen an die Bauern, die für etwas Ruhe auf dem Land sorgten, beschlossen die Konservativen, dass sie vorerst keine Angst vor neuen Aktionen der Bauern haben könnten und dass die Arbeiterbewegung in dieser Zeit eine Rolle spielen könne eine nützliche Rolle im Kampf gegen die Liberalen für die konservative Strategie. Wie auch immer, nach meiner zweiten Rückkehr, nach meiner zweiten Ausweisung ins Ausland, erklärten die Konservativen, dass sie bereit seien, die Überprüfung meines Falles zuzulassen. Der Ausweisungsbeschluss wurde aufgehoben und ein Sondergericht gab mir meine politischen Rechte zurück. Das war im April 1912.
Wir hatten nicht lange Zeit, die Zeit des „friedlichen“ Parteiaufbaus zu genießen. Im Herbst 1912 brach der erste Balkankrieg aus und von diesem Moment an traten Rumänien und die gesamte Balkanhalbinsel in die Ära der Kriege ein. Weniger als ein Jahr nach dem Ende der Balkankriege nahten die Vorboten eines Weltkonflikts. Von August 1914 bis August 1916, als Rumänien in den Krieg eintrat, war der rumänische Sozialdemokrat. Die Partei musste einen sehr schwierigen Kampf ertragen. Innerhalb Rumäniens selbst mussten wir die Neutralität des Landes gegen zwei militärische Parteien verteidigen – die Russophilen und die Germanophilen. Der Kampf beschränkte sich nicht nur auf Zeitungskontroversen, Kundgebungen und Straßendemonstrationen, die in ihrer Schärfe beispiellos waren. Manchmal nahm es einen tragischeren Charakter an. Im Juni 1916 wurden in Galati Arbeiter erschossen. 8 Menschen wurden getötet. Ich wurde verhaftet und eine gerichtliche Untersuchung gegen mich wegen der Organisation einer „Revolte“ gegen die Behörden eingeleitet. Dies löste bei den Arbeitern einen Ausbruch der Empörung aus. In Bukarest wurde ein Generalstreik ausgerufen, der sich auf ganz Rumänien auszuweiten drohte. Offensichtlich hatte die Regierung am Vorabend des Krieges Angst, Unruhe im Land hervorzurufen, und ließ sowohl mich als auch andere verhaftete Kameraden frei.
Im Zeitraum 1914-1916. Meine Tätigkeit beschränkte sich nicht auf den Kampf gegen die rumänische Bourgeoisie und die rumänischen Grundbesitzer. Als Mitglied des Zentralkomitees der Rumänischen Partei habe ich alles in meiner Macht stehende getan, um mit jenen Parteien, Gruppierungen und einzelnen Genossen in Kontakt zu treten, die den Grundsätzen der Arbeiterinternationale im Ausland treu geblieben sind.
Im April 1915 nahm ich auf Einladung der Sozialistischen Partei Italiens an einer internationalen Kundgebung gegen den Krieg in Mailand teil. Auf dem Rückweg nahm er in Bern Kontakt zu Lenin und der Schweizerischen Arbeiterpartei auf. Zuvor hatte ich auch Kontakt zu Trotzki, der damals die Zeitung „Nashe Slovo“ in Paris leitete, wo ich auch schrieb. Diese Verhandlungen und Treffen endeten mit der Einberufung der Zimmerwalder Konferenz.
Zuvor war im Sommer in Bukarest eine Konferenz aller sozialistischen Parteien des Balkans zusammengekommen, die auf einer bestimmten Klassen- und Internationalistenplattform standen. Daher wurde die Partei der bulgarischen opportunistischen Sozialdemokraten (breit) von dieser Konferenz ausgeschlossen. Es wurde eine „revolutionäre sozialdemokratische Arbeiterföderation des Balkans“ gegründet, die die rumänischen, bulgarischen, serbischen und griechischen Parteien umfasste. Es wurde ein zentrales Büro gewählt, dessen Sekretär ich war. So hatten die Balkanparteien bereits vor Zimmerwald ihre Linie des kompromisslosen Kampfes gegen den Imperialismus dargelegt.
Es gelang mir, im Frühjahr 1916 an der Berner Zimmerwalder Konferenz teilzunehmen und dort gemeinsam mit Lenin auf einer internationalen Arbeiterversammlung zu sprechen. Ich hatte keine Gelegenheit mehr, an der Kienthal-Konferenz teilzunehmen, da infolge der Kriegseintrittsvorbereitungen Rumäniens die Grenzen für mich geschlossen waren. Im August 1916 erklärte Rumänien den Krieg und einen Monat später wurde ich verhaftet. Die rumänische Regierung schleppte mich auf dem Rückzug von Bukarest nach Iasi mit. Am 1. Mai 1917 wurde ich von der russischen Garnison in Iasi befreit. Die erste Stadt, die ich nach meiner Entlassung besuchte, war Odessa. Hier begann mein Kampf gegen den Krieg und gegen die Vaterlandsverteidigung. In Petrograd angekommen, setzte ich den gleichen Kampf fort. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch kein Mitglied der Bolschewistischen Partei war und in manchen Fragen nicht mit ihr übereinstimmte, drohte mir die Abschiebung, wenn ich meine Aktivitäten fortsetzte.
Während der Kornilow-Zeit wurde ich von der bolschewistischen Organisation in der Patronenfabrik Sestrorezk versteckt. Von hier aus zog ich nach Kronstadt. Nach der Auflösung des Kornilow-Gebietes beschloss ich, nach Stockholm zu gehen, wo eine Konferenz der Zimmerwalder einberufen werden sollte. Hat mich hierher gebracht Oktoberrevolution . Im Dezember war ich in Petrograd und Anfang Januar reiste ich als Kommissar und Organisator des Rates der Volkskommissare der RSFSR zusammen mit einer von Schelesnjakow angeführten Expedition von Seeleuten in den Süden. Nachdem ich eine gewisse Zeit in Sewastopol verbracht und dort eine Expedition an die Donau gegen die rumänischen Behörden organisiert hatte, die Bessarabien bereits besetzt hatten, brach ich mit der Expedition nach Odessa auf. Hier wurde das Oberste Autonome Kollegium zur Bekämpfung der Konterrevolution in Rumänien und der Ukraine gegründet, und als Vorsitzender dieses Kollegiums und Mitglied von Rumcherod blieb ich in Odessa, bis die Stadt von den Deutschen besetzt wurde. Von Odessa kam ich nach Nikolaev, von dort auf die Krim, dann nach Jekaterinoslaw, wo ich am Zweiten Sowjetkongress der Ukraine teilnahm, dann nach Poltawa und Charkow. Nach meiner Ankunft in Moskau, wo ich im Allgemeinen nicht länger als einen Monat blieb, reiste ich mit einer Delegation nach Kursk, die Friedensverhandlungen mit der ukrainischen Zentralrada führen sollte. In Kursk erhielten wir eine Nachricht über den Putsch Skoropadskys. Hier musste ich einen Waffenstillstand mit den Deutschen schließen, die ihre Offensive fortsetzten. Die Regierung von Skoropadsky hat uns eingeladen, nach Kiew zu kommen. In Kiew bestand die Aufgabe der von mir geleiteten Friedensdelegation darin, vor den Arbeiter- und Bauernmassen der Ukraine die wahre Politik der Sowjetregierung zu klären und sie der Politik von Skoropadsky, der Zentralrada und anderen Agenten des deutschen Imperialismus entgegenzustellen Russische Grundbesitzer. Im September erhielt ich eine Notfallmission nach Deutschland, um dort die Verhandlungen mit der Bundesregierung über den Abschluss eines Friedensvertrages mit der Ukraine fortzusetzen. Von hier aus musste ich nach Wien, wo es zu dieser Zeit bereits eine Republik gab. Während meines Aufenthalts in Berlin erhielt ich die Zustimmung der österreichischen Regierung, deren Außenminister damals der Führer der österreichischen Sozialdemokratie, Viktor Adler, war. Doch die deutschen Behörden erlaubten mir nicht, nach Wien zu reisen. Im Gegenteil, sehr bald wurde ich zusammen mit dem sowjetischen Botschafter in Berlin, Ioffe, Bucharin und anderen Genossen von der deutschen Regierung ausgewiesen. Wir waren noch unterwegs, in Borissow, in deutscher Gefangenschaft, als wir Informationen über die deutsche Revolution erhielten. Einige Zeit später schickte mich das Zentrale Exekutivkomitee zusammen mit anderen Delegierten (Markhlewski, Bucharin, Joffe, Radek, Ignatow) nach Berlin, um am Ersten Kongress der Deutschen Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten teilzunehmen. Aber wir wurden von den deutschen Militärbehörden in Kowno festgenommen und nach mehreren Tagen der „Gefangenschaft“ nach Minsk zurückgebracht. Nach einem kurzen Aufenthalt in Minsk und dann in Gomel, wo die deutsche Regierung damals liquidiert wurde, kam ich in Moskau an. Von dort wurde er vom Zentralkomitee einberufen Kommunistische Partei(b) Ukraine, um den Posten des Vorsitzenden der Provisorischen Revolutionären Arbeiter- und Bauernregierung der Ukraine in der Ukraine zu übernehmen. Der im März 1918 einberufene 3. Gesamtukrainische Sowjetkongress und das aus ihm hervorgegangene Zentrale Exekutivkomitee wählten mich zum Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der Ukraine. Als solcher arbeitete ich bis Mitte September desselben Jahres, zunächst in Charkow, dann in Kiew und nach der Evakuierung Kiews in Tschernigow.
Mitte September traf er in Moskau ein und wurde unter Beibehaltung des Amtes des Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der Ukraine an die Spitze der Politischen Direktion des Revolutionären Militärrats der Republik gestellt. Ich war der Leiter dieser Institution bis Januar, während der schwierigen Tage des Drucks von Denikin, Koltschak und Juden.
Als Charkow von der Macht der Weißen befreit wurde, wurde ich nach einer Weile erneut zum Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der Ukrainischen Sowjetrepublik und zum Mitglied des Revolutionären Militärrats ernannt, zunächst der Südwestfront, der den Krieg beendete Denikin und führte Krieg mit den Polen und wurde anschließend durch den Revolutionären Militärrat der Südfront unter der Leitung des verstorbenen M. V. Frunze ersetzt, an dem ich weiterhin als Mitglied teilnahm. Ich bekleidete gleichzeitig den Posten des Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der Ukrainischen Sowjetrepublik mit dem Posten des Vorsitzenden der Außerordentlichen Kommission zur Bekämpfung des Banditentums, des Vorsitzenden der Außerordentlichen Sanitärkommission, des Vorsitzenden der Sonderkommission für Treibstoff und Lebensmittel, und Vorsitzender des Ukrainischen Wirtschaftsrates. Ich blieb ohne Unterbrechung bis Juli 1923 in der Ukraine, mit Ausnahme der Zeit, als ich mit Tschitscherin, Litwinow und anderen Genossen als Mitglied der sowjetischen Delegation zur Genua-Konferenz ins Ausland reiste.
Im Juli 1923 wurde ich zum Bevollmächtigten nach England ernannt, wo ich die Anerkennung aushandelte die Sowjetunion Die britische Regierung schloss anschließend an der Spitze der sowjetischen Delegation bekannte Vereinbarungen mit MacDonald, die später von der konservativen Regierung, die ihn scheinbar ersetzte, abgelehnt wurden.
Von London aus verhandelte ich zunächst mit Herriot und dann mit Herriot und de Monzy, was mit der Anerkennung der Sowjetunion durch die französische Regierung endete. Ab Ende Oktober 1925 wurde ich als Bevollmächtigter nach Paris versetzt.
Seit 1918 bin ich Mitglied des Zentralen Exekutivkomitees, zunächst der RSFSR, dann der Union, sowie bis 1925 Mitglied ihres Präsidiums. Bis 1924 war ich auch Mitglied des Zentralen Exekutivkomitees der Ukraine. Seit 1919 war ich Mitglied des Zentralkomitees der RCP, dann der KPdSU und bis 1924 Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine und ihres Politbüros.
[1927 wurde er aus der Partei ausgeschlossen, 1935 wurde er wieder aufgenommen. Er arbeitete als Vorsitzender der Union der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Unangemessen unterdrückt. 1938 wurde er im Fall des Rechtstrotzkistischen Antisowjetblocks zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt; 1941 wurde er in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Posthum rehabilitiert.]
Tolle Definition
Unvollständige Definition ↓
Quelle – Wikipedia
Christian Georgievich Rakovsky (Pseudonym Insarov, richtiger Nachname Stanchev: 1. August 1873, Kotel - 11. September 1941) - bulgarischer, sowjetischer Politiker, Staatsmann und Diplomat. Beteiligte sich an der revolutionären Bewegung auf dem Balkan, in Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine.
Enkel des berühmten Revolutionärs Georgi Rakowski. Als ethnischer Bulgare hatte er einen rumänischen Pass. Er besuchte das bulgarische Gymnasium, von wo er zweimal (1886 und 1890) wegen revolutionärer Agitation verwiesen wurde. 1887 änderte er seinen eigenen Namen Kristya Stanchev in den klangvolleren Christian Rakovsky. Ab etwa 1889 wurde er überzeugter Marxist.
Im Jahr 1890 wanderte Christian Rakowski nach Genf in der Schweiz aus, wo er an der medizinischen Fakultät der Universität Genf studierte. In Genf traf Rakowski über russische Emigranten mit der russischen sozialdemokratischen Bewegung zusammen. Insbesondere lernte Rakowski den Begründer der marxistischen Bewegung in eng kennen Russisches Reich Georgi Valentinowitsch Plechanow. Teilnahme an der Organisation des internationalen Kongresses sozialistischer Studenten in Genf. 1893 nahm er als Delegierter aus Bulgarien am Sozialistischen Internationalen Kongress in Zürich teil. Mitarbeit an der ersten bulgarischen marxistischen Zeitschrift „The Day“ und den sozialdemokratischen Zeitungen „Worker“ und „Drugar“ („Genosse“). Laut Rakowskis eigener Autobiographie war dies die Zeit, in der sich sein Hass auf den russischen Zarismus verstärkte. Noch während seines Studiums in Genf reiste er nach Bulgarien, wo er eine Reihe von Berichten las, die sich gegen die zaristische Regierung richteten.
Im Herbst 1893 begann er sein Medizinstudium in Berlin, wurde jedoch aufgrund enger Verbindungen zu den Revolutionären bereits nach sechs Monaten aus Russland ausgewiesen. In Deutschland arbeitete Rakowski mit Wilhelm Liebknecht am Vorwarts zusammen, dem Zentralorgan der deutschen Sozialdemokraten. Im Jahr 1896 schloss er sein Studium an der medizinischen Fakultät der Universität Montpellier in Frankreich ab und erhielt dort den Doktortitel in Medizin.
Ab Herbst 1898 diente er in der rumänischen Armee. Im Frühjahr 1899 demobilisiert.
Nach der Spaltung der SDAPR in Bolschewiki und Menschewiki auf dem Zweiten Kongress 1903 nahm er eine Zwischenposition ein und versuchte, beide Gruppen auf der Grundlage eines Konsenses zu versöhnen. Zwischen 1903 und 1917 war Rakowski zusammen mit Maxim Gorki eines der Bindeglieder zwischen den Bolschewiki, mit denen er im Hinblick auf das Wirtschaftsprogramm sympathisierte, und den Menschewiki, in deren Aktivitäten er positive politische Momente sah. Neben den russischen Revolutionären arbeitete Rakowski in Genf einige Zeit mit Rosa Luxemburg zusammen.
Nach Abschluss seines Studiums in Frankreich kam Rakowski nach St. Petersburg, um seine Dienste bei der Koordinierung der Aktionen von Arbeiter- und marxistischen Kreisen in Russland und im Ausland anzubieten, wurde jedoch bald des Landes verwiesen und ging nach Paris. In Petersburg besuchte Rakowski Miljukow und Struve. Schon damals gab es Gerüchte über Rakowski, er sei ein österreichischer Agent. In den Jahren 1900-1902 hielt er sich erneut in der russischen Hauptstadt auf und kehrte 1902 nach Frankreich zurück.
Obwohl Rakowskis revolutionäre Aktivitäten in dieser Zeit die meisten Länder Europas betrafen, richteten sich seine Hauptbemühungen auf die Organisation einer sozialistischen Bewegung auf dem Balkan, vor allem in Bulgarien und Rumänien. Zu diesem Anlass gründete er in Genf die linke rumänische Zeitung „Sotsial-Demokrat“ und eine Reihe bulgarischer marxistischer Publikationen – „Day“, „Worker“ und „Drugar“ („Genosse“). Von 1907 bis 1914 war er Mitglied des MSB.
Nach seiner Rückkehr nach Rumänien ließ sich Rakowski in der Dobrudscha nieder, wo er als einfacher Arzt arbeitete (1913 war er Gast bei Leo Trotzki). Im Jahr 1910 war er einer der Initiatoren der Restauration unter dem Namen Sozialdemokratische Partei Rumäniens, die bis 1899 existierte, der Sozialistischen Partei Rumäniens, die tatsächlich aufhörte zu existieren, nachdem die „Wohlwollenden“ sie verlassen hatten und a zustimmten Kompromiss mit der königlichen Macht. Die SDPR wurde tatsächlich zur Grundlage für die Gründung der Balkanischen Sozialdemokratischen Föderation im Jahr 1910, die die sozialistischen Parteien Bulgariens, Serbiens, Rumäniens und Griechenlands vereinte. Allein die Existenz einer vereinten Föderation linker Parteien war ein Protest gegen die Politik der Aggression und des Misstrauens, die sich auf dem Balkan infolge der Balkankriege etabliert hatte. Christian Rakovsky, der erste Sekretär der BKF, empfing weiterhin Aktive Teilnahme in der gesamteuropäischen sozialistischen Bewegung, für die er wiederholt aus Bulgarien, Deutschland, Frankreich und Russland ausgewiesen wurde.
Erste Weltkrieg
Während des Ersten Weltkriegs unterstützte Rakowski, wie einige andere Sozialisten, die in Diskussionen über die Methoden des politischen Kampfes zunächst eine zentristische Position einnahmen, den linken Flügel der internationalen Sozialdemokratie, der den imperialistischen Charakter des Krieges verurteilte. Rakovsky war zusammen mit den Führern der linken Sozialisten einer der Organisatoren der internationalen Antikriegs-Zimmerwald-Konferenz im September 1915. Laut D. F. Bradley finanzierten die Österreicher über Rakovsky die in Paris erscheinende russischsprachige Zeitung Nashe Slovo von Martow und Trotzki, 1916 von den französischen Behörden wegen Antikriegspropaganda geschlossen. 1917 bezeichnete der französische General Nissel Rakowski in seinem Bericht als „einen bekannten österreichisch-bulgarischen Agenten“.
Nach dem Kriegseintritt Rumäniens im August 1916 wurde er wegen Verbreitung defätistischer Gefühle und Spionage für Österreich und Deutschland verhaftet. Er blieb bis zum 1. Mai 1917 in Haft und wurde dann von in Ostrumänien stationierten russischen Soldaten freigelassen.
Revolution in Russland
Nach seiner Entlassung aus einem rumänischen Gefängnis kam Rakowski nach Russland. Während der Kornilow-Zeit wurde Rakowski von einer bolschewistischen Organisation in der Patronenfabrik Sestrorezk versteckt. Von dort zog er nach Kronstadt. Dann beschloss Rakowski, nach Stockholm zu gehen, wo eine Konferenz der Zimmerwalders einberufen werden sollte. In Stockholm wurde er von der Oktoberrevolution erfasst. im November 1917 trat er der RSDLP (b) bei und leitete Parteiarbeit in Odessa und Petrograd.
Bürgerkrieg
Als Rakowski im Dezember 1917 in Russland ankam, reiste er Anfang Januar 1918 als Organisationskommissar des Rates der Volkskommissare der RSFSR zusammen mit einer von Schelesnjakow angeführten Matrosenexpedition in den Süden. Nachdem er eine gewisse Zeit in Sewastopol verbracht und dort eine Expedition an die Donau gegen die rumänischen Behörden organisiert hatte, die Bessarabien bereits besetzt hatten, brach er zu einer Expedition nach Odessa auf. Hier wurde das Oberste Autonome Kollegium zur Bekämpfung der Konterrevolution in Rumänien und der Ukraine gegründet, und als Vorsitzender dieses Kollegiums und Mitglied von Rumcherod blieb Rakowski in Odessa, bis die Stadt von den Deutschen besetzt wurde. Von Odessa kam Rakowski nach Nikolaev, von dort auf die Krim, dann nach Jekaterinoslaw, wo er am Zweiten Sowjetkongress der Ukraine teilnahm, dann nach Poltawa und Charkow.
Diplomatische Mission in der Ukraine
Nach seiner Ankunft in Moskau, wo er sich im Allgemeinen nicht länger als einen Monat aufhielt, reiste Rakowski im April 1918 mit einer Delegation nach Kursk, die Friedensverhandlungen mit der ukrainischen Zentralrada führen sollte. Bevollmächtigte Delegierte waren neben Rakowski auch Stalin und Manuilski.
Rakowski war der Haupttreiber all dieser Verhandlungen. Ohne ihn wären die anderen beiden völlig hilflos. Er hatte einen Plan für die staatliche Teilung Russlands. Er zog es vor, die Umsetzung und Entwicklung von Details auf andere zu übertragen. Zu diesem Zweck wurde Manuilsky geschickt. Stalin war offenbar nur ein Beobachter.
In Kursk erhielten die Delegierten eine Nachricht über den Putsch Skoropadskys in Kiew. Mit den Deutschen wurde ein Waffenstillstand geschlossen, die ihre Offensive fortsetzten. Skoropadskys Regierung lud die bolschewistische Delegation nach Kiew ein. Während der Zeit des ukrainischen Staates führte er in Kiew geheime Verhandlungen mit entmachteten Persönlichkeiten der Zentralrada über die Legalisierung der Kommunistischen Partei in der Ukraine.
Diplomatische Mission in Deutschland
Im September 1918 wurde Rakowski auf diplomatische Mission nach Deutschland geschickt, doch bald wurde er zusammen mit dem sowjetischen Botschafter in Berlin, Joffe, Bucharin und anderen Kameraden aus Deutschland ausgewiesen. Auf dem Weg aus Deutschland erreichte die sowjetische Delegation die Nachricht von der Novemberrevolution in Berlin. Beim Versuch, nach Berlin zurückzukehren, wurde Rakowski zusammen mit anderen von den deutschen Militärbehörden in Kowno festgenommen und nach Smolensk geschickt.
Vorsitzender des Rates der Volkskommissare und des Volkskommissars für auswärtige Angelegenheiten der Ukraine
Vorsitzender des Rates der Volkskommissare der Ukraine. Seit 1923 - in der diplomatischen Arbeit: Bevollmächtigter der UdSSR in England, Bevollmächtigter der UdSSR in Frankreich.
Ab 1919 war er Mitglied des Zentralkomitees der RCP(b).
In einem am 10. Januar 1919 nach Moskau geschickten Telegramm forderten Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (b) U Kviring, Fjodor Sergejew, Jakowlew (Epshtein) „sofort Christian Georgievich zu schicken“, um eine Krise des Chefs zu verhindern dass sich die Regierung nicht zu einer Regierungskrise entwickelt. Von Januar 1919 bis Juli 1923 - Vorsitzender des Rates der Volkskommissare und Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten der Ukraine. Gleichzeitig schenkte der Volkskommissar für Innere Angelegenheiten des NKWD von Januar 1919 bis Mai 1920 „minimale Aufmerksamkeit“. Von 1919 bis 1920 war er Mitglied des Organisationsbüros des Zentralkomitees. Einer der Organisatoren der Sowjetmacht in der Ukraine.
Als zu Beginn des Jahres 1922 die Frage nach einer möglichen Versetzung Rakowskis an einen anderen Arbeitsplatz aufkam, beschloss das Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (b) der Ukraine am 23. März 1922, „kategorisch zu fordern, dass Genosse Rakowski nicht abgesetzt werde.“ aus der Ukraine."
Als Teil der sowjetischen Delegation nahm er an der Arbeit der Genua-Konferenz (1922) teil.
Im Juni 1923 wurde auf Initiative von Rakowski ein Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine angenommen, wonach ausländische Unternehmen ihre Niederlassungen in der Ukraine nur mit Genehmigung ihrer Behörden eröffnen durften. Alle in Moskau geschlossenen Handelsverträge wurden annulliert. Einen Monat später wurde dieser Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine aufgehoben.
XII. Kongress der RCP (b)
Auf dem 12. Kongress der RCP(b) wandte er sich entschieden gegen Stalins nationale Politik. Auf diesem Kongress erklärte Rakowski, dass „neun Zehntel ihrer Rechte den Unionskommissariaten entzogen und auf die nationalen Republiken übertragen werden müssen“. Im Juni 1923 beschuldigte Stalin Rakowski und seine Mitarbeiter auf der IV. Sitzung des Zentralkomitees der RCP (b) mit hochrangigen Beamten der nationalen Republiken und Regionen des Konföderalismus, der nationalen Abweichung und des Separatismus. Einen Monat nach dem Ende dieses Treffens wurde Rakowski seines Amtes als Vorsitzender des Rates der Volkskommissare der Ukraine enthoben und als Botschafter nach England (1923-1925) entsandt. Am 18. Juli schickte Rakowski einen Brief an Stalin und in Kopien an alle Mitglieder des Zentralkomitees und der Zentralen Kontrollkommission der RCP (b), Mitglieder des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine, in dem er darauf hinwies : „Meine Ernennung nach London ist für mich, und nicht nur für mich allein, nur ein Vorwand für meine Entlassung aus der Ukraine.“ Zu dieser Zeit brach ein Skandal im Zusammenhang mit dem „Zinowjew-Brief“ aus. Von Oktober 1925 bis Oktober 1927 - Bevollmächtigter in Frankreich. Er war Leiter der sowjetischen diplomatischen Vertretung in London
Linke Opposition in der RCP(b) und der KPdSU(b)
Seit 1923 gehörte er der Linken Opposition an und war einer ihrer Ideologen. 1927 wurde er aller Ämter enthoben, aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen und auf dem XV. Kongress der KPdSU (b) unter 75 „aktiven Oppositionellen“ aus der Partei ausgeschlossen. Auf einer Sondersitzung der OGPU wurde er zu vier Jahren Verbannung verurteilt und nach Kustanai verbannt. 1931 wurde er erneut zu vier Jahren Verbannung verurteilt und nach Barnaul verbannt. Lange Zeit hatte er eine negative Einstellung gegenüber den „Kapitulatoren“, die zur Partei zurückkehrten, um den Kampf fortzusetzen, doch 1935 verkündete er zusammen mit einem anderen hartnäckigen Oppositionellen, L. S. Sosnovsky, seinen Bruch mit der Opposition. N. A. Ioffe schrieb darüber: „Er glaubte, dass es zweifellos eine bestimmte Schicht in der Partei gibt, die unsere Ansichten in der Seele teilt, sich aber nicht traut, sie auszudrücken. Und wir könnten einer nach dem anderen zu einer Art vernünftigem Kern und so etwas werden.“ , sagte er, sie werden uns überfahren wie Hühner. Er wurde nach Moskau zurückgebracht und im November 1935 wieder in die KPdSU aufgenommen (b).
Im Jahr 1934 wurde er von G. N. Kaminsky in einer leitenden Position im Volkskommissariat für Gesundheit der RSFSR aufgenommen.
Dritter Moskauer Prozess
1936 wurde er erneut aus der Partei ausgeschlossen und am 27. Januar 1937
Es geschah alles im selben grausamen Jahr 1937. Halb zu Tode geprügelt und sadistisch verstümmelt, bat der Mann den Ermittler um einen Bleistift und sagte mit unerwartet fester Stimme:
— Haben Sie um ein Geständnis gebeten? Jetzt werden sie es tun. Ich werde schreiben...
— Das wäre schon lange so gewesen“, schmunzelte der Ermittler. Aber denken Sie daran: „Ich bin an nichts schuld“ funktioniert bei uns nicht. Schreiben Sie also die Wahrheit.
— Ja, ja, ich werde die Wahrheit schreiben.
Überraschenderweise ist dieser unbeholfen gekritzelte Zettel erhalten geblieben, er wird in die Akte abgelegt und schreit, ich habe keine Angst vor diesem Wort, förmlich.
„Bisher habe ich nur um Verzeihung gebeten, aber nicht über den Fall geschrieben. Jetzt werde ich eine Erklärung verfassen, in der ich eine Überprüfung meines Falles mit einer Beschreibung aller „Geheimnisse des Madrider Gerichts“ fordere. Lassen Sie zumindest die Menschen, durch deren Hände alle möglichen Aussagen gehen, wissen, wie schlechte Taten und Prüfungen aus persönlicher politischer Rache „gekocht“ werden. Lass mich bald sterben, lass mich eine Leiche sein ... Eines Tages werden die Leichen sprechen.“
Dieses „irgendwann“ ist gekommen. Und auch wenn der Autor dieser Zeilen, Christian Rakowski, nicht sprechen kann, werden zahlreiche Dokumente, Memoiren von Freunden und vor allem seine Taten über ihn berichten.
Als Kämpfer, Verteidiger und Revolutionär Krystyo (das ist sein richtiger bulgarischer Name) hat Rakovsky sozusagen die Tatsache seiner Geburt zum Scheitern verurteilt. Einer seiner Verwandten, Georgi Mamatschow, kämpfte bis an sein Lebensende gegen die Türken, ein anderer, Georgi Rakowski, wurde aus den gleichen Gründen zum Nationalhelden. Es ging so weit, dass Christian bereits als Teenager offiziell auf seinen Nachnamen Stanchev verzichtete und zu Rakovsky wurde.
Ein solcher Nachname ist sehr dankbar und Christian beginnt zu handeln. Im Alter von 14 Jahren verursacht er einen Aufruhr in der Turnhalle, für den er sofort auf die Straße geworfen wird. Christian zog nach Gabrovo und begann, die Stimmung unter den dortigen Gymnasiasten zu trüben, indem er sich selbst als konsequenten Sozialisten bezeichnete. Diesmal wurde er nicht nur aus dem Gymnasium, sondern auch aus dem Land geworfen, wodurch ihm das Recht entzogen wurde, seine Ausbildung in Bulgarien fortzusetzen.
Der junge Sozialist musste nach Genf ziehen und eine Prüfung an der medizinischen Fakultät der Universität ablegen. Doch schon als Student verbrachte Christian seine ganze Zeit nicht so sehr in Laboren und Anatomen, sondern in unterirdischen Redaktionen und unauffälligen Cafés, wo sich die ganze Couleur der rebellischen europäischen Emigration versammelte. Dort lernte Christian Georgi Plechanow, Wera Sasulich, Karl Kautsky, Jean Jaurès und sogar Friedrich Engels kennen. Dann begann er mit Iskra zusammenzuarbeiten, und zwar von der ersten Ausgabe an.
Rakowski kam 1897 zum ersten Mal nach Russland. Dann war er 24 Jahre alt und reiste nicht so sehr zum internationalen Ärztekongress nach Moskau, sondern ... um zu heiraten. Seine Auserwählte war Elizaveta Ryabova, die Tochter eines Künstlers der kaiserlichen Theater. Ihre Ehe war glücklich, aber von kurzer Dauer: Fünf Jahre später starb Elizabeth während der Geburt.
Dann kam 1905, das Jahr der ersten russischen Revolution. Im ganzen Land kam es zu bewaffneten Aufständen, die bis auf einen alle brutal niedergeschlagen wurden. Wie die Zeitungen in jenen Jahren schrieben: „Das Schlachtschiff Potemkin war und bleibt das ungeschlagene Territorium der Revolution.“ Wie Sie sich wahrscheinlich erinnern, begann alles mit Borschtsch aus Wurmfleisch, dann dem Massaker an den am meisten gehassten Offizieren, dem Einmarsch in Odessa, der Beerdigung des verstorbenen Anführers des Aufstands, dem Durchbruch des aus Sewastopol eingetroffenen Geschwaders und dem erzwungenen Festmachen Rumänisches Constanta.
Hätten die rumänischen Behörden die Matrosen den zaristischen Behörden übergeben, wären sie mit Sicherheit erschossen worden. Ohne Rakowski wäre es wahrscheinlich so gewesen. Er organisierte Kundgebungen zur Verteidigung der Seeleute, veröffentlichte Brandartikel, brachte das gesamte fortschrittliche Europa auf die Beine, brachte Tausende von Demonstranten auf die Straße – und die rumänischen Behörden kapitulierten: Sie erlaubten 700 Seeleuten, an Land zu gehen, und das Schlachtschiff wurde zurückgegeben nach Russland. Etwas später schrieb Rakowski ein Buch über die Ereignisse rund um Potemkin: Dieses Buch bildete die Grundlage für das Drehbuch zu Eisensteins weltberühmtem Film.
In denselben Jahren ereignete sich ein Ereignis, das für sein Schicksal eine fatale Rolle spielte: Rakowski lernte Trotzki kennen und freundete sich mit ihm an. Sie wurden so enge Freunde, dass sie einander Bücher widmeten. Auf der Titelseite eines von ihnen schrieb insbesondere Trotzki: „Christian Georgievich Rakovsky, einem Kämpfer, einem Mann, einem Freund, widme ich dieses Buch.“ Und auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs widmete Trotzki nach einem der Treffen in der Schweiz seinem alten Freund einen ganzen Artikel.
„Rakowski ist eine der ‚internationalsten‘ Figuren der europäischen Bewegung. Rakovsky ist gebürtiger Bulgare, aber rumänischer Staatsbürger, ausgebildeter französischer Arzt, aber in Bezug auf Verbindungen, Sympathien und literarische Arbeit ein russischer Intellektueller. Er spricht alle Balkansprachen und drei europäische Sprachen und beteiligt sich aktiv am Innenleben von vier sozialistische Parteien – bulgarische, russische, französische und rumänische“, schrieb er in der Zeitung „Berner Garde“.
Etwas später, im Jahr 1922, als Trotzki auf dem Höhepunkt seiner Macht und Popularität war, sagte er in einer seiner Reden:
— Das historische Schicksal wollte, dass Rakowski, ein gebürtiger Bulgare, Franzose und Russe mit allgemeiner politischer Bildung, rumänischer Staatsbürger mit Pass, Regierungschef in der Sowjetukraine wird.
Ja, ja, wundern Sie sich nicht, 1917 zog Rakowski schließlich nach Russland, wurde Bolschewik, Kommissar der Abteilung des berühmten Seemanns Schelesnjakow, desselben Schelesnjakow, der die Verfassunggebende Versammlung praktisch auflöste, und kämpfte dann gegen Denikins Truppen und war es auch beim Verlassen der Einkesselung tödlich verwundet.
Und am Ende wäre Rakowski beinahe Diplomat geworden 1918- gehen. Tatsache ist, dass gerade zu dieser Zeit in Deutschland die sogenannte Novemberrevolution stattfand und der Sowjetkongress Deutschlands angekündigt wurde. Lenin beschloss sofort, eine Delegation zum Kongress zu entsenden, zu der auch Rakowski gehörte. So kam es, dass die Delegation von kaisertreuen Offizieren abgefangen wurde und Lenins Gesandte beinahe erschossen wurden. Als die deutsche Revolution vorbei war, wurde Rakowski zum Bevollmächtigten in Wien ernannt. Die österreichischen Behörden stimmten zu, aber die Deutschen weigerten sich, ihn durch ihr Gebiet zu lassen – und er erreichte Wien nicht. *
Da der Bürgerkrieg in vollem Gange war, wurde Rakowski als Mitglied des Revolutionären Militärrats entweder an die Süd- oder an die Südwestfront geschickt, wo er Hand in Hand mit Michail Frunse und dem späteren Marschall der Sowjetunion Alexander kämpfte Jegorow. Und Rakowski wurde im Januar Vorsitzender des Rates der Volkskommissare der Ukraine 1919- und blieb in dieser Position bis 1923. Doch bereits 1922 gehörte er zur Delegation, die zur Konferenz von Genua reiste. Kurz nach seiner Fertigstellung wurde Rakowski zum stellvertretenden Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten ernannt und sofort als halber Vertreter nach London entsandt.
Die Beziehungen zu England waren damals sehr schlecht. Eines der Hauptprobleme, das den Aufbau für beide Seiten vorteilhafter Beziehungen verhinderte, waren die Schulden des zaristischen Russlands. Die Sowjetregierung weigerte sich zunächst, diese Schulden anzuerkennen: Die Arbeiterklasse, so heißt es, habe kein Geld von der englischen Bourgeoisie genommen, und was das verstaatlichte Eigentum angeht, seien alle diese Fabriken und Fabriken von russischen Arbeitern und zu Recht gebaut worden gehören dem Volk und nicht den britischen Aktionären. Dann stellte London klar, dass von einer de jure-Anerkennung der UdSSR keine Rede sein könne. Die Sowjetunion wird zu einem Paria-Land, mit dem niemand Handel treiben oder diplomatische Beziehungen unterhalten wird.
In diesem Moment erschien Christian Rakovsky in London. So beschrieben die damaligen Zeitungen seinen ersten „Auftritt“:
„Als Rakowski den Saal betrat, fesselte er die Ansichten der gesamten Gesellschaft an sich. Er war ein wirklich charmanter Mann, der mit seinen Manieren und seiner edlen Haltung Sympathie hervorrief. Er war sofort von Schriftstellern, Journalisten, Wissenschaftlern, Künstlern, Politikern und Diplomaten umgeben. Mit jedem sprach er in der entsprechenden Sprache – Englisch, Französisch, Deutsch oder Rumänisch. Er beantwortete Fragen mit Leichtigkeit, mal – diplomatisch, mal – mit Zurückhaltung, mal – mit etwas Ironie. Das Publikum erwartete, einen unhöflichen Bolschewisten zu sehen, und Rakowski beeindruckte alle mit seiner Gelehrsamkeit, Anmut, seinem Adel, seiner Bildung und seiner Hochkultur.
Dem ersten „Auftritt“ folgten ein zweiter, ein dritter, dann herzliche Gespräche mit Politikern, Bankern und Unternehmern. Dadurch wurde das Schuldenproblem gelöst und die Sowjetunion de jure anerkannt. Es war ein Sieg, ein großer Sieg für die junge sowjetische Diplomatie! Die Iswestija erkannte sofort die Verdienste Rakowskis. Warum gibt es „Izvestia“, der englische Historiker Carr, und er konnte nicht widerstehen und nannte Rakowski „den besten Diplomaten“. 1920er Jahre“.
Als klar wurde, dass die Beziehungen zu England reibungslos verliefen, kam die Wende nach Frankreich. Allen war klar, dass niemand außer Rakowski das Problem der Beziehungen zu Frankreich lösen konnte, und im Oktober 1925 wurde er nach Paris versetzt. Er verbrachte zwei Jahre in Frankreich. Während dieser Zeit wurden Marcel Cachin, Louis Aragon, Henri Barbusse, Elsa Triolet, Georges Sadoul, Ernest Hemingway und viele andere weltberühmte Kulturschaffende seine engen Freunde. Was die Politik betrifft, Gemeinsame Sprache Rakowski fand es bei ihnen: Auf jeden Fall waren alle Probleme der gegenseitigen Beziehungen zwischen Moskau und Paris gelöst.
Im Jahr 1927 kehrte Christian Georgievich nach Moskau zurück und beteiligte sich sofort an einer Diskussion über Kritik an Stalins Methoden der Führung des Landes und der Partei. Er spricht auf Kundgebungen, Versammlungen und sogar auf dem 15. Parteitag und argumentiert, dass „nur ein Regime der innerparteilichen Demokratie die Entwicklung der richtigen Linie der Partei sicherstellen und ihre Verbindungen zur Arbeiterklasse stärken kann“. Er wurde sofort als „parteiinterner Oppositioneller“ bezeichnet, aus der Partei ausgeschlossen und nach Astrachan verbannt.
Fünf Jahre des Schweigens, fünf Jahre erzwungener Untätigkeit, und schließlich beschloss Rakowski im Jahr 1934, Buße zu tun: Er schickte einen Brief an das Zentralkomitee, in dem er erklärte, dass er „die allgemeine Linie der Partei anerkennt und bereit ist, alles zu geben.“ seine Stärke, die Sowjetunion zu verteidigen.“ Seltsamerweise wurde der Brief in der Iswestija veröffentlicht – und bald wurde Rakowski wieder in die Partei aufgenommen und sogar zum Vorsitzenden des All-Union-Roten Kreuzes ernannt, das kann man von seiner Spezialität her sagen: Er ist ausgebildeter Arzt. Eine Zeit lang durfte er nur ins Ausland reisen, doch nach ein paar Jahren besuchte Christian Georgievich an der Spitze einer offiziellen Delegation Japan.
Rakowski durfte sich nicht an diplomatischen Angelegenheiten beteiligen und war daher völlig ratlos. „Wo ist das Volkskommissariat für Gesundheit – und wo ist Japan? Warum gehe ich dorthin und nicht zum Volkskommissar? er dachte.
Es klärte sich ziemlich schnell auf, im selben House of Unions, wo Gerichtsverhandlungüber den rechten Trotzki-Block, an dem neben Bucharin, Rykow und vielen anderen auch Christian Rakowski aktiv beteiligt war. Dann wurde er zum englischen Spion erklärt – weil er Bevollmächtigter in London war, und zum japanischen Spion – weil er mit einer Delegation dorthin reiste. Man möchte fragen: War das nicht Absicht oder wurde er nach Japan geschickt, um dann einen Spionagevorwurf zu schmieden?
Über Vorwürfe des Trotzkismus muss nicht gesprochen werden: Trotzkis lobende und enthusiastische Artikel über „einen Freund, einen Mann und einen Kämpfer“ waren in aller Munde.
Die Ermittlungen dauerten acht Monate, Rakowski bekannte sich acht Monate lang nicht schuldig, dann bat er um einen Bleistift und kritzelte genau die Notiz, in der er eine Überprüfung seines Falles forderte und versprach, zu erzählen, wie schlechte Taten „gekocht“ wurden. .. Offenbar fiel er danach in die Hände von Schultermeistern: Er war im Prozess nicht wiederzuerkennen. Aber was mich am meisten beeindruckt hat: Im letzten Wort bekannte sich Rakowski buchstäblich in allem schuldig. Und er beendete seine Rede eher kryptisch.
— „Ich halte es für meine Pflicht“, sagte er, mit meinem Bekenntnis zum Kampf gegen den Faschismus beizutragen.
Was hat Faschismus damit zu tun? Wie kann sein Geständnis diesem Kampf helfen?
Wie kann Hitler durch seine reuige Aussage geschädigt werden, er sei ein anglo-japanischer Spion gewesen und habe versucht, das bestehende System in der UdSSR zu stürzen? Es ist unmöglich, das zu verstehen... Die einzige einigermaßen vernünftige Erklärung ist das Versprechen einer milderen Strafe. Und so geschah es übrigens. Rakowski erhielt keinen „Turm“, sondern 20 Jahre Gefängnis, nachdem er in das berüchtigte Oryol Central geworfen worden war.
Schon in den ersten Monaten Vaterländischer Krieg Es stellte sich die Frage, was mit den Gefangenen in der Orjol-Zentrale geschehen sollte: Die Deutschen rückten näher und, was nützte es, sie könnten sie freilassen. Beria schlug eine radikale Lösung vor, und Stalin unterstützte ihn: die Verbrecher in die Lager im Ural und in Sibirien zu überführen – wenig später würden sie hervorragendes Material für die Strafbataillone werden – und die politischen zu erschießen.
Um die Formalität zu wahren, wurden am 8. September die Fälle der in Abwesenheit befindlichen politischen Personen nach Liste überprüft, alle wurden zum Tode verurteilt und am 3. Oktober wurde das Urteil vollstreckt. Einer der ersten, der die Kugel des Henkers erhielt, war Christian Georgievich Rakovsky, derselbe Rakovsky, der Urheber der ersten Siege der sowjetischen Diplomatie war und in den europäischen Hauptstädten als der beste Diplomat der 1920er Jahre galt.
Boris Sopelnyak
Aus dem Buch „Geheimarchiv des NKWD-KGB“
Christian Georgievich Rakovsky(Pseudonym Insarov, gegenwärtig Nachname Stanchev, geborener Bulgare. Christo Rakowski; Rum. Cristian Racovschi, Ukrainer Khristiyan Georgiyovich Rakovsky; 1. August 1873, Kotel - 11. September 1941) - sowjetische politische, staatliche und diplomatische Persönlichkeit. Beteiligte sich an der revolutionären Bewegung auf dem Balkan, in Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine.
Jugend
Enkel des berühmten Revolutionärs Georgi Rakowski. Als ethnischer Bulgare hatte er einen rumänischen Pass. Er besuchte das bulgarische Gymnasium, von wo er zweimal (1886 und 1890) wegen revolutionärer Agitation verwiesen wurde. 1887 änderte er seinen eigenen Namen Kristya Stanchev in den klangvolleren Christian Rakovsky. Ab etwa 1889 wurde er überzeugter Marxist.
Beteiligung an revolutionären Aktivitäten
Im Jahr 1890 wanderte Christian Rakowski nach Genf in der Schweiz aus, wo er an der medizinischen Fakultät der Universität Genf studierte. In Genf traf Rakowski über russische Emigranten mit der russischen sozialdemokratischen Bewegung zusammen. Insbesondere lernte Rakowski den Gründer der marxistischen Bewegung im Russischen Reich, Georgi Valentinowitsch Plechanow, kennen. Teilnahme an der Organisation des internationalen Kongresses sozialistischer Studenten in Genf. 1893 nahm er als Delegierter aus Bulgarien am Sozialistischen Internationalen Kongress in Zürich teil. Mitarbeit an der ersten bulgarischen marxistischen Zeitschrift „The Day“ und den sozialdemokratischen Zeitungen „Worker“ und „Drugar“ („Genosse“). Laut Rakowskis eigener Autobiographie war dies die Zeit, in der sich sein Hass auf den russischen Zarismus verstärkte. Noch während seines Studiums in Genf reiste er nach Bulgarien, wo er eine Reihe von Berichten las, die sich gegen die zaristische Regierung richteten.
Im Herbst 1893 begann er sein Medizinstudium in Berlin, wurde jedoch aufgrund enger Verbindungen zu den Revolutionären bereits nach sechs Monaten aus Russland ausgewiesen. In Deutschland arbeitete Rakowski mit Wilhelm Liebknecht bei Vorwärts, dem Zentralorgan der deutschen Sozialdemokraten, zusammen. Im Jahr 1896 schloss er sein Studium an der medizinischen Fakultät der Universität Montpellier in Frankreich ab und erhielt dort den Doktortitel in Medizin.
Ab Herbst 1898 diente er in der rumänischen Armee. Im Frühjahr 1899 demobilisiert.
Nach der Spaltung der SDAPR in Bolschewiki und Menschewiki auf dem Zweiten Kongress 1903 nahm er eine Zwischenposition ein und versuchte, beide Gruppen auf der Grundlage eines Konsenses zu versöhnen. Zwischen 1903 und 1917 war Rakowski zusammen mit Maxim Gorki eines der Bindeglieder zwischen den Bolschewiki, mit denen er im Hinblick auf das Wirtschaftsprogramm sympathisierte, und den Menschewiki, in deren Aktivitäten er positive politische Momente sah. Neben den russischen Revolutionären arbeitete Rakowski in Genf einige Zeit mit Rosa Luxemburg zusammen.
Nach Abschluss seines Studiums in Frankreich kam Rakowski nach St. Petersburg, um seine Dienste bei der Koordinierung der Aktionen von Arbeiter- und marxistischen Kreisen in Russland und im Ausland anzubieten, wurde jedoch bald des Landes verwiesen und ging nach Paris. In Petersburg besuchte Rakowski Miljukow und Struve. In den Jahren 1900-1902 hielt er sich erneut in der russischen Hauptstadt auf und kehrte 1902 nach Frankreich zurück.
Obwohl Rakowskis revolutionäre Aktivitäten in dieser Zeit die meisten Länder Europas betrafen, richteten sich seine Hauptbemühungen auf die Organisation einer sozialistischen Bewegung auf dem Balkan, vor allem in Bulgarien und Rumänien. Bei dieser Gelegenheit gründete er in Genf die linke rumänische Zeitung Sotsial-Demokrat und eine Reihe bulgarischer marxistischer Publikationen – Den, Rabotnik und Drugar (Genosse). Von 1907 bis 1914 war er Mitglied des MSB.
Nach seiner Rückkehr nach Rumänien ließ sich Rakowski in der Dobrudscha nieder, wo er als einfacher Arzt arbeitete (1913 war er Gast bei Leo Trotzki). Im Jahr 1910 war er einer der Initiatoren der Wiederherstellung der bis 1899 bestehenden Sozialistischen Partei Rumäniens unter dem Namen Sozialdemokratische Partei Rumäniens, die nach dem Austritt der „Wohlwollenden“ mit ihrer Zustimmung tatsächlich aufhörte zu existieren ein Kompromiss mit der königlichen Macht. Die SDPR wurde tatsächlich zur Grundlage für die Gründung der Balkanischen Sozialdemokratischen Föderation im Jahr 1910, die die sozialistischen Parteien Bulgariens, Serbiens, Rumäniens und Griechenlands vereinte. Allein die Existenz einer vereinten Föderation linker Parteien war ein Protest gegen die Politik der Aggression und des Misstrauens, die sich auf dem Balkan infolge der Balkankriege etabliert hatte. Christian Rakowski, der erste Sekretär der BKF, beteiligte sich gleichzeitig weiterhin aktiv an der gesamteuropäischen sozialistischen Bewegung, wofür er wiederholt aus Bulgarien, Deutschland, Frankreich und Russland ausgewiesen wurde.
Erster Weltkrieg
Während des Ersten Weltkriegs unterstützte Rakowski, wie einige andere Sozialisten, die in Diskussionen über die Methoden des politischen Kampfes zunächst eine zentristische Position einnahmen, den linken Flügel der internationalen Sozialdemokratie, der den imperialistischen Charakter des Krieges verurteilte. Rakowski war zusammen mit den Führern der Linkssozialisten einer der Organisatoren der internationalen Antikriegs-Zimmerwalder Konferenz im September 1915.
Ein Agent der Mittelmächte, der daran arbeitet, Russland zu besiegen?
Bereits während Rakowskis Aufenthalt in St. Petersburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es Gerüchte über ihn, er sei ein österreichischer Agent.
Der Erste Weltkrieg selbst wurde von zahlreichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Politik als ein Kampf zwischen Fortschritt und Demokratie (Deutschland) bzw. Reaktion und Autokratie (Russland) betrachtet, auf dessen Grundlage sie auf eine Niederlage Russlands im Krieg setzten. Diese Ansichten wurden insbesondere von Israel Gelfand (Alexander Parvus) vertreten, der praktische Schritte unternahm, um die militärische Niederlage Russlands zu organisieren. Als „Spezialist für den Balkan und die Türkei“ kam er im Januar 1915 nach Bukarest, wo Rakowski die örtliche sozialdemokratische Organisation leitete und die Tageszeitung herausgab. Die Ziele von Gelfands Besuch in Rumänien bestanden darin, die rumänische Politik hin zu einer pro-deutschen zu ändern, insbesondere die entsprechende Politik der rumänischen Sozialdemokraten und die Organisation eines Zentrums zur Destabilisierung der Lage in der Ukraine, im Kaukasus und in Rumänien in Rumänien die Schwarzmeerhäfen Russlands - Odessa und Nikolaev. Die weitere Entwicklung der Ereignisse deutete darauf hin, dass Rakowski den Plänen von Helphand für Russland zustimmte und seine Bereitschaft zum Ausdruck brachte, finanzielle Unterstützung von Helphand für die rumänische Partei anzunehmen. Vom Vertreter des deutschen Außenministeriums in Rumänien, von Busche-Haddenhausen, ist eine Nachricht erhalten geblieben, die drei Tage nach Gelfands Ankunft in Bukarest nach Berlin geschickt wurde und ihm mitteilte, dass er die Möglichkeit habe, „unsichtbar“ 100.000 Lei an die rumänischen Sozialisten zu überweisen wegen „Antikriegspropaganda“. Die Zustimmung Berlins wurde eingeholt. Allerdings berichtete Rakowski später auf dem Parteitag, dass Gelfand der einzige sei, der einer sozialistischen Zeitung 300 Lei gespendet habe. Auf demselben Kongress rief Rakowski zu einer sozialistischen Massendemonstration für den Frieden auf und wurde, wie Boucher schrieb, „von mir und dem österreichisch-ungarischen Minister“ unterstützt:157 .
Durch Rakowski wurde die 1914–1916 in Paris erscheinende russischsprachige Tageszeitung Nashe Slovo finanziert. Martow und Trotzki vertreten Antikriegspositionen. Die Zeitung wurde von den französischen Behörden wegen Antikriegspropaganda geschlossen. Trotzki selbst erinnerte sich später in New York daran, dass das Geld für die Veröffentlichung der Zeitung „hauptsächlich von Rakowski stammte“. Laut D. F. Bradley steckten die Österreicher dahinter. Der Historiker Zbinek Zeman glaubte, dass Rakowski Geld von Gelfand bekam – Ende März 1915 erhielt er die erste Million Deutsche Mark für „Friedenspropaganda“ in Russland, von denen ein Teil nach Bukarest überwiesen wurde, wo Gelfand selbst Anfang April zu einem Treffen eintraf mit von Bushe und Rakovsky. Helphand gelang es offenbar, Rakowski davon zu überzeugen, einen Teil dieser Summe für die Unterstützung von Trotzkis Zeitung zu verwenden:178.
Nachdem Rumänien im August 1916 auf der Seite der Entente in den Krieg eingetreten war, wurde Rakowski unter dem Vorwurf der Verbreitung defätistischer Gefühle und der Spionage für Österreich und Deutschland verhaftet. Er war bis zum 1. Mai 1917 in Iasi inhaftiert und wurde dann von der demokratisierten russischen Garnison freigelassen. Nach der Niederlage Rumäniens im Krieg erschien Rakowski im neutralen Stockholm und wandte sich an den deutschen Vertreter in Schweden mit der Bitte, seiner Frau die Reise über deutsches Territorium nach Schweden zu ermöglichen. Der bereits erwähnte von Busche, der zu diesem Zeitpunkt als stellvertretender Staatssekretär im deutschen Außenministerium tätig war, reagierte positiv auf Rakovskys Anfrage und bemerkte: „Rakovsky hat in der Vergangenheit für uns in Rumänien gearbeitet“: 158 .
1917 bezeichnete der französische General Nissel Rakowski in seinem Bericht als „einen bekannten österreichisch-bulgarischen Agenten“.
Revolution in Russland
Nach seiner Entlassung aus einem rumänischen Gefängnis kam Rakowski nach Russland. Während der Kornilow-Zeit wurde Rakowski von einer bolschewistischen Organisation in der Patronenfabrik Sestrorezk versteckt. Von dort zog er nach Kronstadt. Dann beschloss Rakowski, nach Stockholm zu gehen, wo eine Konferenz der Zimmerwalders einberufen werden sollte. In Stockholm wurde er von der Oktoberrevolution erfasst. im November 1917 trat er der RSDLP (b) bei und leitete Parteiarbeit in Odessa und Petrograd.
Bürgerkrieg
Als Rakowski im Dezember 1917 in Russland ankam, reiste er Anfang Januar 1918 als Organisationskommissar des Rates der Volkskommissare der RSFSR zusammen mit einer von Schelesnjakow angeführten Matrosenexpedition in den Süden. Nachdem er eine gewisse Zeit in Sewastopol verbracht und dort eine Expedition an die Donau gegen die rumänischen Behörden organisiert hatte, die Bessarabien bereits besetzt hatten, brach er zu einer Expedition nach Odessa auf. Hier wurde das „Oberste Autonome Kollegium zur Bekämpfung der Konterrevolution in Rumänien und der Ukraine“ (das lokale Analogon der Allrussischen Tscheka) gegründet, und als Vorsitzender dieses Kollegiums und Mitglied von Rumcherod blieb Rakowski bis zur Stadt in Odessa wurde von den Deutschen besetzt. Von Odessa kam Rakowski nach Nikolaev, von dort auf die Krim, dann nach Jekaterinoslaw, wo er am Zweiten Sowjetkongress der Ukraine teilnahm, dann nach Poltawa und Charkow.
Diplomatische Mission in der Ukraine
Nach seiner Ankunft in Moskau, wo er sich im Allgemeinen nicht länger als einen Monat aufhielt, reiste Rakowski im April 1918 mit einer Delegation nach Kursk, die Friedensverhandlungen mit der ukrainischen Zentralrada führen sollte. Bevollmächtigte Delegierte waren neben Rakowski auch Stalin und Manuilski.
In Kursk erhielten die Delegierten eine Nachricht über den Putsch Skoropadskys in Kiew. Mit den Deutschen wurde ein Waffenstillstand geschlossen, die ihre Offensive fortsetzten. Skoropadskys Regierung lud die bolschewistische Delegation nach Kiew ein. Während der Zeit des ukrainischen Staates führte er in Kiew geheime Verhandlungen mit entmachteten Führern der Zentralrada über die Legalisierung der Kommunistischen Partei in der Ukraine.
Diplomatische Mission in Deutschland
Er sprach gleichermaßen gut Rumänisch, Bulgarisch, Russisch und mehrere andere europäische Sprachen. Und es ist nicht bekannt, welche Sprache seine Muttersprache ist. Ich erinnere mich, dass ich ihn einmal gefragt habe: In welcher Sprache denkt er? Rakovsky dachte einen Moment nach und sagte: „Wahrscheinlich das, was ich gerade spreche.“
Aus den Erinnerungen der Tochter von Adolf Ioffe
Im September 1918 wurde Rakowski auf diplomatische Mission nach Deutschland geschickt, doch bald wurde er zusammen mit dem sowjetischen Botschafter in Berlin, Joffe, Bucharin und anderen Kameraden aus Deutschland ausgewiesen. Auf dem Weg aus Deutschland erreichte die sowjetische Delegation die Nachricht von der Novemberrevolution in Berlin. Beim Versuch, nach Berlin zurückzukehren, wurde Rakowski zusammen mit anderen von den deutschen Militärbehörden in Kowno festgenommen und nach Smolensk geschickt.
Vorsitzender des Rates der Volkskommissare und des Volkskommissars für auswärtige Angelegenheiten der Ukraine
In einem am 10. Januar 1919 nach Moskau geschickten Telegramm forderten Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (b) U Kviring, Fjodor Sergejew, Jakowlew (Epshtein) „sofort die Entsendung von Christian Georgievich“, um die Krise der Kommunistischen Partei zu verhindern Regierungschefs vor einer Regierungskrise bewahren. Von Januar 1919 bis Juli 1923 war Rakowski Vorsitzender des Rates der Volkskommissare und Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten der Ukraine. Gleichzeitig schenkte der Volkskommissar für Innere Angelegenheiten des NKWD von Januar 1919 bis Mai 1920 „minimale Aufmerksamkeit“. Einer der Organisatoren der Sowjetmacht in der Ukraine. Ab 1919 war er Mitglied des Zentralkomitees der RCP(b). Von 1919 bis 1920 war er Mitglied des Organisationsbüros des Zentralkomitees. Ende 1919 stand das gesamte Territorium der Ukraine unter der Kontrolle von bewaffnete Kräfte Südrussland, Ukrainisch Volksrepublik und Polen. Unter diesen Bedingungen wurde das Allukrainische Revolutionskomitee gegründet, das vom 17. Dezember 1919 bis 19. Februar 1920 das höchste gesetzgebende und exekutive Machtorgan der Ukraine war und von G. I. Petrovsky geleitet wurde. Am 19. Februar 1920, nach der Befreiung des größten Teils der Ukraine, wurde die Tätigkeit des Rates der Volkskommissare der Ukraine wieder aufgenommen.
Als zu Beginn des Jahres 1922 die Frage nach einer möglichen Versetzung Rakowskis an einen anderen Arbeitsplatz aufkam, beschloss das Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (b) der Ukraine am 23. März 1922, „kategorisch zu fordern, dass Genosse Rakowski nicht abgesetzt wird“. aus der Ukraine."
Als Teil der sowjetischen Delegation nahm er an der Arbeit der Genua-Konferenz (1922) teil.
Im Juni 1923 wurde auf Initiative von Rakowski ein Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine angenommen, wonach ausländische Unternehmen ihre Niederlassungen in der Ukraine nur nach Genehmigung der Behörden eröffnen durften. Alle in Moskau geschlossenen Handelsverträge wurden annulliert. Einen Monat später wurde dieser Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine aufgehoben.
XII. Kongress der RCP(b)
Auf dem 12. Kongress der RCP(b) wandte er sich entschieden gegen Stalins nationale Politik. Auf diesem Kongress erklärte Rakowski, dass „neun Zehntel ihrer Rechte den Unionskommissariaten entzogen und auf die nationalen Republiken übertragen werden müssen“. Im Juni 1923 beschuldigte Stalin Rakowski und seine Mitarbeiter auf der IV. Sitzung des Zentralkomitees der RCP (b) mit hochrangigen Beamten der nationalen Republiken und Regionen des Konföderalismus, der nationalen Abweichung und des Separatismus. Einen Monat nach dem Ende dieses Treffens wurde Rakowski seines Amtes als Vorsitzender des Rates der Volkskommissare der Ukraine enthoben und als Botschafter nach England (1923-1925) entsandt. Am 18. Juli schickte Rakowski einen Brief an Stalin und in Kopien an alle Mitglieder des Zentralkomitees und der Zentralen Kontrollkommission der RCP (b), Mitglieder des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine, in dem er darauf hinwies : „Meine Ernennung nach London ist für mich, und nicht nur für mich allein, nur ein Vorwand für meine Entlassung aus der Ukraine. Zu dieser Zeit brach ein Skandal im Zusammenhang mit dem „Sinowjew-Brief“ aus. Von Oktober 1925 bis Oktober 1927 - Bevollmächtigter in Frankreich.
Interessanterweise machte sich Rakowski Sorgen um den Dichter Sergej Jesenin. So bittet Rakowski in einem Brief von Kh. G. Rakovsky an F. E. Dzerzhinsky vom 25. Oktober 1925, „das Leben des berühmten Dichters Jesenin, zweifellos des talentiertesten in unserer Union, zu retten“ und bietet an: „Laden Sie ihn zu sich ein.“ , mach es gut und schicke es zusammen mit ihm in das Sanatorium eines Kameraden von der GPU, der ihn nicht betrinken ließ ... ". Auf dem Brief befindet sich Dzerzhinskys Resolution, die an seinen engen Freund, Sekretär und Chef der GPU V. D. Gerson gerichtet ist: „M. b., schaffst du das? Daneben steht Gersons Notiz: „Ich habe wiederholt angerufen – ich konnte Yesenin nicht finden.“ (Jesenin beging am 25.12.1925 Selbstmord).
Linke Opposition in der RCP(b) und der KPdSU(b)
Seit 1923 gehörte er der Linken Opposition an und war einer ihrer Ideologen. 1927 wurde er aller Ämter enthoben, aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen und auf dem XV. Parteitag der KPdSU (b) unter 75 „aktiven Oppositionellen“ aus der Partei ausgeschlossen. Auf einer Sondersitzung der OGPU wurde er zu vier Jahren Verbannung verurteilt und nach Kustanai verbannt. 1931 wurde er erneut zu vier Jahren Verbannung verurteilt und nach Barnaul verbannt. Lange Zeit hatte er eine negative Einstellung gegenüber den „Kapitulatoren“, die zur Partei zurückkehrten, um den Kampf fortzusetzen, doch 1935 verkündete er zusammen mit einem anderen hartnäckigen Oppositionellen, L. S. Sosnovsky, seinen Bruch mit der Opposition. N. A. Ioffe schrieb dazu: „Er glaubte, dass es zweifellos eine bestimmte Schicht in der Partei gibt, die unsere Ansichten in der Seele teilt, es aber nicht wagt, sie auszudrücken.“ Und wir könnten zu einer Art vernünftigem Kern werden und etwas tun. Und einer nach dem anderen, sagte er, werden sie uns wie Hühner übergehen. Die Tochter von A. K. Voronsky, Galina Voronskaya, erinnerte sich daran, dass ihr Vater 1929 bei einem Treffen mit Stalin „versuchte, für Rakowski einzutreten, der damals ein Oppositioneller im Astrachaner Exil war:“ Es ist ein zu großer Luxus für die Partei, um solch hochgebildete Menschen in den Provinzen zu halten. Er wurde nach Moskau zurückgebracht und im November 1935 wieder in die KPdSU aufgenommen (b).
Im Jahr 1934 wurde er von G. N. Kaminsky in einer leitenden Position im Volkskommissariat für Gesundheit der RSFSR aufgenommen.
Dritter Moskauer Prozess
1936 wurde er erneut aus der Partei ausgeschlossen. Am 27. Januar 1937 wurde er aufgrund eines Sonderberichts von N. I. Jeschow an I. W. Stalin verhaftet.
Er wurde im inneren Gefängnis des NKWD festgehalten; mehrere Monate lang weigerte er sich, sich der ihm vorgeworfenen Verbrechen schuldig zu bekennen; Doch am Ende scheiterte er und im März 1938 trat er als Angeklagter im Prozess gegen den „Antisowjetischen Rechts-Trotzki-Block“ auf. bekannte sich der Teilnahme schuldig verschiedene Verschwörungen und auch, dass er ein japanischer und englischer Spion war. Am 13. März 1938 gehörte er (neben Bessonow und Pletnew) zu den drei Angeklagten, die nicht zum Tode, sondern zu 20 Jahren Haft verurteilt wurden Haft mit Vermögenseinziehung. Im letzten Wort sagte er: „Unser Unglück ist, dass wir verantwortungsvolle Positionen innehatten, die Macht hat uns den Kopf verdreht.“ Diese Leidenschaft, dieses Streben nach Macht hat uns blind gemacht.“
Zu Rakowskis Verhalten im Prozess schrieb ein anderer Oppositioneller, Victor Serge: „Er schien den Prozess absichtlich durch Aussagen zu gefährden, deren Falschheit für Europa offensichtlich ist …“. Eine weitere Erklärung liefert der Oberste Gerichtshof der UdSSR in seinem Beschluss vom 4. Februar 1988: „Selbstbelastung wurde durch Täuschung, Erpressung, geistige und körperliche Gewalt erreicht.“
Ausführung
Er verbüßte seine Strafe im Oryol Central. Nach Ausbruch des Großen Vaterländischen Krieges wurde Rakowski, wie auch die mit ihm verurteilten Bessonow und Pletnew, laut Stalins Listen am 11. September 1941 im Medwedew-Wald erschossen.
Rehabilitation
Am 4. Februar 1988 wurde er vom Plenum des Obersten Gerichtshofs der UdSSR rehabilitiert und am 21. Juni 1988 durch Beschluss der KPCh des Zentralkomitees der KPdSU wieder in die Partei aufgenommen.
Christian Georgievich Rakovsky (richtiger Name - Stanchev) (1873-1941) wurde in Kotel (Bulgarien) in der Familie einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens geboren. Bulgare nach Nationalität. Ausbildung: höher – Abschluss an der medizinischen Fakultät der Universität Montpellier in Frankreich. Im Jahr 1893 traf G. V. Plechanow und stand von da an der russischen revolutionären Bewegung nahe. 1898-1899. diente in der Armee und wurde aus gesundheitlichen Gründen demobilisiert. In 1900 Kh.G. Rakowski wurde von der Geheimdienstabteilung des Generalstabs von Österreich-Ungarn rekrutiert und konzentrierte sich auf die Infiltration russischer Revolutionskreise. Während seines Aufenthalts in Russland in den Jahren 1900–1902 freundete sich Rakowski eng mit P. B. Struve, P. N. Miljukow, W. I. Lenin und J. L. Martow an. Im Jahr 1907 schloss sich den Bolschewiki an, unterhielt aber enge Beziehungen zu L.D. Trotzki, der damals in Opposition zu Lenin stand. Er wurde von der russischen Spionageabwehr überwacht, aber aus irgendeinem Grund wurde er nicht festgenommen. Rakowski gehörte zu den Menschen, die große Geldsummen von „Interessenten“ im Westen zu den Bolschewiki transportierten – für die Veröffentlichung der Presse, Flugblätter, für den Kauf gefälschter Dokumente und Waffen. Hinter einer solchen „Philanthropie“ standen sehr oft die Interessen ausländischer Geheimdienste, und in diesem Fall Österreich-Ungarns. Im Jahr 1915 Rakowski fühlte sich von einem der wichtigsten „Sponsoren“ der Bolschewiki – A. Parvus – angezogen, und Rakowski überwies bereits Geld von ihm an Trotzki und Lenin. Im Jahr 1916 Rakowski wurde in Rumänien wegen Spionage für Österreich-Ungarn und Deutschland verhaftet, jedoch nach der Russischen Revolution im Mai 1917. freigelassen und nach Schweden ausgereist. Im Dezember 1917 kehrte er nach Russland zurück und erhielt sofort von Lenin einen Termin nach Sewastopol, wo er mit Hilfe von Matrosen Abteilungen der Roten Garde organisierte. Zunächst ordnete Rakowski die Geiselnahme unter den „besitzenden Klassen“ und Offizieren an; Die meisten Marineoffiziere wurden auf seinen Befehl hingerichtet. Die Matrosen von Rakowski veranstalteten Massenraubüberfälle in der Stadt; Rakowski behinderte sie nicht, sondern ermutigte sie im Gegenteil zu solchen Aktionen, da er sie als „wirklich revolutionäre Energie der Proletarier“ betrachtete. Diejenigen, die versuchten, ihr Eigentum zu schützen, wurden ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Dann organisierte Rakowski einen „Feldzug an die Donau“: ein Versuch von Seeleuten, Bessarabien zu erobern, aber daraus wurde nichts: Die vorrückenden rumänischen Truppen besiegten diese undisziplinierte Horde leicht; außerdem verfügte Rakowski über keine militärischen Kenntnisse. Danach kam Rakowski nach Odessa, wo er das „Temporäre Autonome Kollegium zur Bekämpfung der Konterrevolution in Rumänien und der Ukraine“ gründete. Rakowski konnte sich nicht „in voller Breite“ umdrehen: Die deutsche Offensive hinderte ihn daran, aber es gelang ihm, große Geiselgruppen zu erschießen. Die schwersten Hinrichtungen fanden in Razdelnaya, Balta, Tiraspol und Nikolaev statt. Insbesondere in Nikolaev wurden alle Gefangenen des Stadtgefängnisses hingerichtet.
Er nahm an Verhandlungen mit der Regierung der ukrainischen Zentralrada teil, wurde jedoch im November 1918 zur revolutionären Arbeit nach Berlin geschickt. wurde von den Deutschen verhaftet und deportiert. Und im Januar 1919. Rakowski wurde gleichzeitig Vorsitzender des Rates der Volkskommissare (bis 1923) und des NKWD der Ukraine (bis 1920). Er förderte aktiv die Idee der Schaffung von „Arbeitsarmeen“, zeichnete sich aber vor allem durch die Durchführung der sogenannten „Kommunisierung“ aus – einem Versuch, eine großflächige Landwirtschaft zu schaffen, in der nicht nur Land, sondern auch Das Leben wurde verallgemeinert: Rakowski beseitigte das getrennte Wohnen, verbot das individuelle Kochen, verbot die Pflege eines Gartens oder eines Gartens, eines kleinen Vogels. Sogar das Geschirr wurde geteilt. In seinem Eifer ging er bis zu Regulierungsversuchen intime Beziehungen zwischen Ehegatten: hat diesbezüglich mehrere Anweisungen verfasst. Er machte die Teilnahme an politischen Kursen zur Pflicht und Rakowski sanktionierte körperliche Züchtigung für „Abweichler“.
Er genehmigte die äußerst grausame Unterdrückung der Bewegung von Ataman Grigoriev: Er befahl den Beschuss der Dörfer, deren Bevölkerung Grigoriev unterstützte, und befahl wiederholt, keine Gefangenen zu machen. Ein erheblicher Teil der Zivilbevölkerung versuchte, das Gebiet der Kämpfe der Roten Armee mit Grigoriev zu verlassen und nach Rumänien zu ziehen, doch Rakovsky befahl, die Flüchtlinge mit Maschinengewehrfeuer und Kartätschen aufzuhalten und sie daran zu hindern, das Gebiet zu überqueren Dnister, wo damals die Grenze war. Es muss gesagt werden, dass nicht alle Kommandeure der Roten Armee solche Befehle ausführten: Beispielsweise weigerte sich G. I. Kotovsky, auf die Flüchtlinge zu schießen, und hinderte sie nicht daran, ins Ausland zu gehen.
Im Jahr 1923 Er unterstützte Trotzki, woraufhin er von der Arbeit in Kiew entlassen und als Botschafter nach London geschickt wurde. Von 1925 bis 1927 war er Bevollmächtigter in Frankreich. Rakowski betrachtete seinen Wechsel in die diplomatische Arbeit als „Link“ und nicht als seinen direkten Offizielle Pflichten war damit beschäftigt, Trotzki beim Aufbau von Kontakten zu seinen Anhängern im Ausland zu helfen. Darüber hinaus nahm Rakowski 1923 Kontakt zu britischen und französischen Geheimdienstleuten auf: Später behauptete er, er habe es „im Namen Trotzkis getan“. Im Dezember 1927 wurde aus der Partei ausgeschlossen, aus ihrem Zentralkomitee zurückgezogen und nach Kustanai und dann nach Barnaul verbannt. Er hielt es für notwendig, illegale Organisationen zu gründen, die sich auf die physische Vernichtung der prominentesten Vertreter des Regimes konzentrieren. Um die Gelegenheit dazu zu bekommen, ahmte er 1935 die „Versöhnung“ mit Stalin nach. Er wurde wieder in die KPdSU aufgenommen (b) und erhielt eine Führungsposition im Volkskommissariat für Gesundheit. Er wurde jedoch vom NKWD genau beobachtet: Die Terrorpropaganda, die Rakowski unter den jungen Leuten betrieb, die er in seine Zellen rekrutierte, blieb nicht unbemerkt, und zwar im Januar 1937. Rakowski wurde verhaftet.
Im März 1938 Kh.G. Rakovsky wurde der Spionage und der Vorbereitung terroristischer Anschläge für schuldig befunden und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Er bekannte sich voll und ganz zu seiner Schuld. Er verbüßte seine Strafe im Oryol Central. Am 11. September 1941 wurden einige der Gefangenen im Zusammenhang mit der drohenden Eroberung von Orel durch deutsche Truppen ohne Gerichtsverfahren oder Ermittlungen erschossen. Unter ihnen wurde auch Kh.G. Rakovsky erschossen. Zusammen mit ihm wurden zwei seiner Komplizen, Bessonov und Pletnev, erschossen.
Im Jahr 1988 Christian Rakowski wurde vollständig rehabilitiert und wieder in die KPdSU aufgenommen.
//Ukrainische historische Zeitschrift. 2002. Nr. 1. (auf Ukrainisch)
//Russische Vergangenheit. Buch 1. M..1991.
Zeman Z., Sharlau U. Anerkennung für den Parvus-Plan der Revolution. M., 2007.
Landovsky I. Rote Symphonie. M., 1996.
Felshtinsky Yu.G Trotzkis Archiv. T.7. M., 2009.
Ataman Grigoriev war ein ukrainischer Sozialrevolutionär. Zunächst war er ein Verbündeter der Roten, wurde aber von ihnen desillusioniert. Er wurde von einem bedeutenden Teil der Bauern der Provinzen Odessa, Nikolaev, Cherson und Bessarabien unterstützt. Mehr dazu: Ryabchikov S.V. „Grüne“ im Süden Russlands. Neue Materialien. M., 2008., Belash V.A. Straßen von Nestor Machno. M., 1996.
Mehr dazu: Shulgin V.V. Tage.1920. M., 1991.
Ioffe N.A. Vor langer Zeit. M., 1992. (Nadezhda Adolfovna Ioffe ist die Tochter eines sowjetischen Diplomaten, A.A. Ioffe, eines Verbündeten Trotzkis, und sie wusste viel).
Zazubrin V. KGB. M., 2010.
Rogowin V.Z. Die Partei der Hingerichteten. M., 1998.
Der Befehl zur Durchführung der Hinrichtung wurde von B.Z. Kobulov erteilt.
//Fragen zur Geschichte der KPdSU. 1989. Nr. 7.